Schloss Stollberg - Verwaltungszentrum des kursächsischen Amtes Stollberg - Michel Hilbert
Zur Veröffentlichung auf Qucosa (urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-987660)
Schloss Stollberg Stand 26.08.2025 (PDF, 23.45 MB)
- Schloss Stollberg - Verwaltungszentrum des kursächsischen Amtes Stollberg - Michel Hilbert
- Einleitung
- 1. Schloß Stollberg und Vorwerk um 1564
- 2. Schloss Stollberg und Vorwerk zwischen 1564 und 1702
- Anmerkung historische Kartographie
- Entwicklung zwischen dem Kauf Kurfürst August 1564 und dem Brand des neuen Hauses 1602
- Entwicklung zwischen dem Brand des neuen Hauses und dem Dreißigjährigen Krieg
- Zerstörungen im Dreißigjährigen Krieg laut [Q1632]
- Entwicklung nach dem Dreißigjährigen Krieg bis 1701
- altes Haus
- neues Haus
- kleines Haus hinter den Amtsstuben
- Bergfried
- kleiner Turm
- Pferdestall
- Weitere potentielle Gebäude im und am Schloß
- Anmerkung historische Kartographie
- 3. Schloss Stollberg und (Kammer)gut Hoheneck zwischen 1702 und 1815
- Im Besitz von Gottlob Friedrich Nester zwischen 1702 und 1736
- Nach dem Tod Nesters im Jahr 1736 bis zum Rückkauf des Gutes "Hoheneck" durch die sächsische Kammer im Jahr 1752
- Zwischen dem Rückkauf des Kammerguts im Jahr 1752 und dem Umzug des Amtshauses im Jahr 1771 in das sogenannte „Bertholdische Haus“ in der Stadt
- Zwischen dem Umzug des Amtshauses im Jahr 1771 vom Schloss in das sogenannte „Bertholdische Haus“ in der Stadt und dem erneuten Umzug in das „Rößlerische Haus“ am Markt im Jahr 1802
- kleines Haus hinter der ehemaligen Amtsstube (jetzt Amtsfrohnveste)
- 4. Schloss Stollberg und Kammergut Hoheneck zwischen 1815 und 1862
- Zwischen dem Neubau des Amtshauses ab 1809 auf dem Schlossgelände und der Zerschlagung des Kammerguts 1845
- Zwischen Zerschlagung des Kammerguts im Jahr 1845 und Einrichtung der (Weiber-) Strafanstalt im Jahr 1862
- Burg (Gebäude im Uhrzeigersinn - 2 erst 1857 nachweisbar)
- 1. Amtsfrohnveste[P1815a][P1815b], Die Amtsfrohnveste mit dem Thorhause[P1857] (neues Haus)
- 2. Holz- und Strohschuppen[P1857]
- 3. Holz Schuppen für den Amtsfrohn [P1815a], Thatsbestandseffectenbehältniss und Baugerätheschuppen[P1857] (kleines Haus)
- 4. Wasserhaus[P1857]
- 5. Neu erbautes Amtshaus[P1815a], Das Amthaus mit der Justizbeamten- und der Actuariatswohnung[P1857]
- 6. Schuppen und Stallgebäude zu dem Amthaus gehörig[P1815a], Gemeinschaftliches Schuppengebäude mit Stallung und den Kellern[P1857]
- Kammergut (Gebäude im Uhrzeigersinn)
- Gärten im Schloss oder Vorwerk
- Kellereingänge
- Gegenüberstellungen zwischen 1840 und 1841
- 5. Umgestaltung zur (Weiber-) Strafanstalt nach 1862
- Fazit/ Schlussbetrachtung
- Anhang
- Schösser und Vorwerkspächter
- Inventare
- Inventargruppe 1 "neues Haus" (Besitzungen des Amtsschössers im Schloss) - 1584[S1584], 1597[S1597] , 1602[S1602] und direkt nach dem Brand im Jahr 1602[S1618]
- Inventargruppe 2a "altes Haus" (Besitzungen des Vorwerkspächters im Schloss) - 1626[S1626], 1633[S1633a][S1633b][S1633c][S1633d][S1633e][S1633f], 1640[S1640a][S1640b]
- Inventargruppe 2b "altes Haus" (Besitzungen der Vorwerkspächters im Schloss) - 1670[S1670a][S1670b][S1670c]
- Inventargruppe 3a "Vorwerk" (Besitzungen des Vorwerkspächters im Vorwerk) - 1567[V1567], 1568[V1568], 1584[V1584], 1591 (Erbbuch)[V1591],1598[V1598a][V1598b], 1608[V1608], 1614[V1614],1626[V1626], 1633[V1633a][V1633b][V1633c][V1633d][V1633e][V1633f], 1640[V1640a][V1640b]
- Inventargruppe 3b "Vorwerk" (Besitzungen des Vorwerkspächters im Vorwerk) - 1670[V1670a][V1670b][V1670c]
- Inventargruppe 4 Schloss- und Vorwerksgebäude - 1681[V1681]
- Inventargruppe 5 Schloss- und Vorwerksgebäude - 1701 [V1701]
- Inventargruppe 6a Vorwerksgebäude - 1796 [V1796a]
- Inventargruppe 6b Vorwerksgebäude - 1828[V1828], 1833[V1833b]
- 7 Übersicht Zerschlagung des Kammerguts 1845 - Bildung eines Stammgutes
- Abbildungen/ Darstellungen/ Bilder
- 1. Schlussstein 1564 / 1887
- 2. Simon Hoffmann - Schloss Stollberg 1615 - Entwurf 1 (Umbaupläne nicht ausgeführt)
- Überblick historische Ansichten Schloss Stollberg
- Kartenübersicht 1 - zwischen 1564 und 1790
- Kartenübersicht 2 - zwischen 1800 und 1825
- Kartenübersicht 3 - zwischen 1857 und 1883
- Kartenübersicht 4 - zwischen 1875 und 1943
- Kartenübersicht 5 - Riße zwischen 1864 und 1900 bei der Strafanstalt
- Sonstiges/ Quellen
- Quellen
- Literatur
- Impressum
Einleitung
Die vorliegende Arbeit wurde von mir im Zeitraum zwischen Oktober 2024 und August 2025 für meine private Webseite www.fergunna.de angefertigt und dient als Grundlage für meine zukünftig geplante Forschung zum Thema „Jagdgeschichte unter Kurfürst August im Amt Stollberg“. Die Untersuchung basiert größtenteils auf Primärquellenforschung im Hauptstaatsarchiv Dresden, wobei insbesondere der Bestand 10036 Finanzarchiv (33.1434.002 Finanzarchiv – Hoheneck – Schloss und Vorwerk) als zentrale Quelle herangezogen wurde.
Ziel dieses privaten Projekts war es, die Gebäude des Schlosses Stollberg mithilfe originaler Archivalien aus dem Zeitraum von 1564 bis 1864 zu rekonstruieren. Die Ergebnisse der Quellenforschung wurden anschließend in 3D-Modelle überführt, um einen anschaulichen Einblick in die bauliche Entwicklung und den strukturellen Aufbau des Schlosses zu ermöglichen.
26.08.2025
Michel Hilbert
1. Schloß Stollberg und Vorwerk um 1564
Ausgangssituation vor dem Verkauf der Herrschaft und Schloss Stollberg an den Kurfürsten. Das "neue Haus" unter Kurfürst August wurde noch nicht errichtet.
Geschichtliche Entwicklung
Auf eine ausführliche Darstellung der Zeit vor 1564 soll an dieser Stelle verzichtet werden. Stattdessen sei auf die bereits vorhandenen, detaillierten Ausarbeitungen im Kapitel „Literatur“ verwiesen, insbesondere auf die grundlegenden Werke von Löscher [L1932_1940] und Schmidt [L1976_1978]. Nichtsdestotrotz liefern einige Quellen bis 1564 wertvolle Hinweise auf die ältere Bausubstanz der „Staleburc“:
- 1244 erfolgt die erste urkundliche Erwähnung des Schlosses Stollberg durch einen gewissen „Hugo von Staleburc“ (Schmidt I S. 79 [L1976_1978]).
- 1291 ist Burg Stollberg erstmals nachweislich Ausstellungsort einer Urkunde (17.01.1291, S. 5 [L2018a]).
- 1399 berichten die Einträge in der Schwarzburger Chronik des Jovius von einer Belagerung des Schlosses und des Vorwerks durch Heinrich von Plauen und Sigismund von Schönburg; das Vorwerk wurde in Brand gesteckt, und auch am Schloss richtete Geschützfeuer beträchtlichen Schaden an (Schmidt I S. 79 [L1976_1978]).
- Die älteste bekannte Amtsrechnung aus dem Jahr 1423/24 gibt einen Einblick in die frühere Verwaltung und Nutzung des Schlosses. In diesem Zusammenhang wird ein „Nickel Roder“, Vogt „dort in Stalburg“, erwähnt. Darüber hinaus finden sich Hinweise auf eine Küche, einen Keller, verschiedene Gebäude (nicht näher spezifiziert) sowie eine Scheune (S. 20 [L1932_1940])
- 1445 wird die Schlosskapelle erwähnt, als ein Kaplan namens „Albertus capellanus in castro Stalburg“ (zugleich Amtsschreiber) genannt wird (S. 16 [L1993]). Der Altarinhaber hatte jährlich vier Mark Silber an den Bischof zu entrichten (S. 126 [L1922], siehe auch Meissner Bistumsmatrikel Jahr 1346/1495 "Altare in castro" CDS I A 1 S. 215).
Personen auf dem Schloss vor dem Erwerb durch Kurfürst August im Jahr 1564
Wertvolle Informationen über auf dem Schloss Stollberg tätige Personen vor dem Übergang an Kurfürst August liefert das durch Bernd Descher wiederentdeckte, älteste erhaltene Bergbuch der ehemaligen Herrschaft Stollberg. Es enthält Einträge aus den Jahren 1501 bis 1562 (S. 19 [L1994_1996]).
Laut Descher wurde das Bergbuch im Jahr 1562 von einem Kopisten aus drei älteren Bergbüchern der Familie von Schönberg zusammengeführt. Der Entstehungshintergrund ist vermutlich im seit 1555 schwelenden Regalienstreit (Bergbau) zwischen Kurfürst August und den Schönbergern zu sehen.
Besonders bemerkenswert ist der angegebene Erstellungsort des Bergbuchs: eine „Thuer stube“ (Torstube) auf dem Schlossgelände. Der Eintrag lautet: „Geschehenn zu Stolbergk uffn schloes daselbstenn Ihn der Thuer stuben, Mittwoch nach Quaismodo geniti Anno domini XV. und im LXIIten“(= 20. April 1562) Ob es sich dabei bereits um die spätere erwähnte Torstube im neuen Haus (wahrscheinlich erst um 1564 erbaut) handelt oder um einen Raum in einem anderen Gebäude (eventuell im alten Haus), lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen.
Aus dem Bergbuch lassen sich folgende Personen mit Funktionen auf dem Schloss Stollberg zwischen 1501 und 1562 nachweisen ([Q1501]):
- um 1506: Seyfridus Seler („uff Stolburgk Capplan“)
- um 1511: Heinrich Brockschlegell („Amptman zu Stolbergk“)
- um 1512: Nicolaus Jacobi („Schösser und Vorleyher der Herrschafft zu Stolbergk“)
- mindestens 1536 bis mindestens 1548: Wolff Ragewitz (Schösser und gleichzeitig Bergmeister der Schönberger)
Auch Mitglieder des Adelsgeschlechts der Schönberger, als Lehnsherren, sind mit der Herrschaft nachweislich verbunden:
- mindestens 1515 bis mindestens 1537: Fridrich von Schönbergk „uff Stollbergk“
- mindestens 1512 bis mindestens 1548: Heinrich von Schönbergk
Der Übergang der Herrschaft Stollberg an den Kurfürsten August (1563/1564)
Zwischen 1473 und 1564 besaßen die Herren von Schönberg die Herrschaft Stollberg als wettinisches Lehen, wobei das Schloss stets das Zentrum dieses Territoriums darstellte. 1563 traten die Schönberger in Kaufverhandlungen mit Kurfürst August ein, wobei die genauen Hintergründe bis heute nicht eindeutig geklärt sind. Friedrich Schmidt vermutet Geldknappheit der Familie Schönberg infolge von Erbstreitigkeiten oder einen gewissen Druck seitens des Kurfürsten, der auf das wildreiche Waldgebiet und das Schloss als Jagdsitz abzielte. Letzteres wird dadurch untermauert, dass unmittelbar nach dem Verkauf die sogenannten„Jagdstallungsriße“ (Kartenwerke für die kurfürstliche Jagd) für das Amt Stollberg entstanden. Neben der Jagd dürfte, wie bereits von Bernd Descher beschrieben, auch das Bergregal eine weitere wichtige Rolle gespielt haben. Im Jahr 1564 erwarb Kurfürst August schließlich für 74 222 fl. die gesamte Herrschaft einschließlich Schloss, wandelte sie in ein kursächsisches Amt um und schloss damit räumlich die Lücke zwischen dem Amt Grünhain und dem Amt Chemnitz [L1976_1978]. Die Schönberger zogen sich auf das Rittergut Niederzwönitz zurück.[L1976_1978]
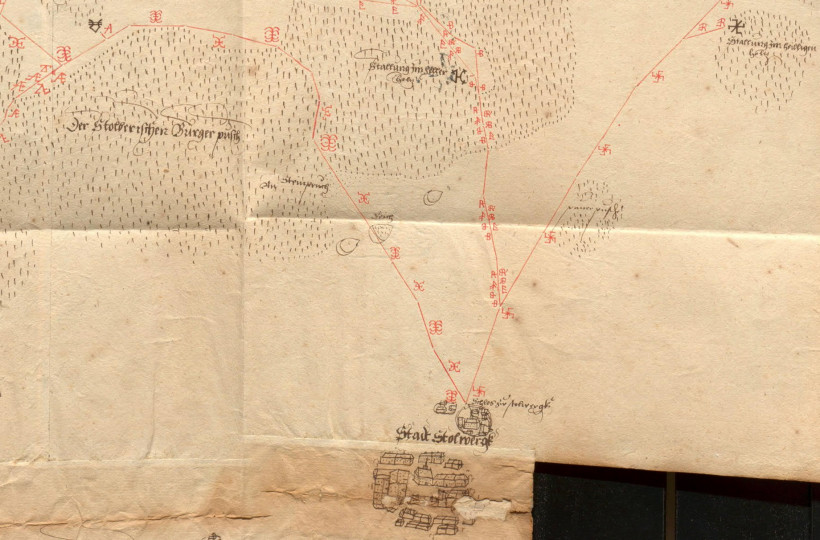
Abbildung 1: Jagdstallungsriß um 1570 mit Schloss und Vorwerk (mit Teichen und Steinbruch in der Nähe)[P1570a]
Der Kaufabschluss führte zugleich zu einer detaillierten Bestandsaufnahme des Schlosses, die sich im sogenannten „Anschlag von 1563“ [Q1563] erhalten hat. Hauptquellen für die damalige Baugeschichte sind die beiden Beschreibungen „Das Gebeude auffm Schlos“ (fol. 13v [Q1563-1]) und „Stollbergk das Schloß“ (fol. 28r [Q1563-2]). Beide Beschreibungen stimmen in vielen Details – etwa im Hinweis auf ein „altes Haus“ – überein, bieten jedoch auch einige zusätzliche Informationen. So heißt es in einer weiteren zeitnahen Beschreibung: „Ein schloß midt Zimlichen gemachen, stuben, Cammern/ Kuechen/ Kellern/ schuedt bodemen, pferde stellen, Rhor wassern, Eine bade stuben, vnd andere notturfft.“ [Q1564_1568]. Auffällig ist der lobende Hinweis auf das „stark lebendigk Rohrwasser“ sowie die betonten „stargke mauren welche an etlichenn orttenn gemessenn“ sind, was auf ein solides Mauerwerk verweist. Insgesamt scheinen Schloss und Vorwerk zu dieser Zeit in gutem Zustand gewesen zu sein, wovon Formulierungen wie „zu guther und uberflussiger nottorftt vorsehenn“ sprechen.
Mit dem Übergang in den kurfürstlichen Besitz beginnt schließlich die in den folgenden Abschnitten detaillierter behandelte Epoche, in der das Schloss und Vorwerk Stollberg zum Mittelpunkt des kursächsischen Amt ausgebaut wurden.
Gebäudeübersicht
Laut [Q1563-2] besteht das Schloss aus 3 "Heuser"/ Gebäuden:
Burg
- "das gebeude auffm Schlos"[Q1563-1] (das spätere "alte Haus")
- 8 Stuben
- 13 Kammern
- 4 Gewölbe ("guten geraumen gewelben")
- 1 Kapelle
- Küchen (wahrscheinlich mehr als eine)
- 3 Speisekammern
- 3 Keller
- Pferdestall mit einer Kapazität für einige bis 20 Pferde (wird wahrscheinlich nicht als Gebäude gezählt)
- Packhaus (wahrscheinlich ein Lagerhaus)
- "andern eingebeuden" (wahrscheinlich Bergfried/ Turm inbegriffen)
Vorwerk
- Brau-, Gär- und Mälzhaus (um 1563 als "neu erbautt" beschrieben)
- Badestube (um 1563 als "neu erbautt" beschrieben)
- Viehhaus (um 1563 als "neu erpautt wol geraum" beschrieben)
- Stall für Milchkühe (um 1563 als "stallung vors Melckvihe mit guthen schuttboden" beschrieben)
- Scheunen ("Scheuren")
- Ställe
- Schuppen
- Schäferei
- Käsehaus
- Dörrhaus ("Dher und Weschhausse")
- Waschhaus (Dher und Weschhausse)
- zwei Häuser in der Stadt Stollberg (nicht auf dem Schlossgelände)
2. Schloss Stollberg und Vorwerk zwischen 1564 und 1702
Zwischen der Errichtung des neuen Hauses durch Kurfürst August und dem Verkauf an Akzisrat Nester.
Anmerkung historische Kartographie
Historische Karten und Darstellungen aus jener Epoche sind selten und oft nur unzureichend genau. Innerhalb der überlieferten kartografischen Zeugnisse vermitteln die Jagdstallungsriße um 1570 [P1570a] und die erste kursächsische Landesaufnahme [P1615b] lediglich einen schemenhaften Überblick über das Schloss, das Vorwerk und die umliegende Landschaft. Aussagen zu einzelnen Gebäuden lassen sich daraus nicht im Detail ableiten, da die Jagdstallungsriße Schloss und Vorwerk nur grob skizzieren. Wie in meiner Ausarbeitung zu den Jagdstallungsrißen dargelegt, repräsentieren die dort gezeigten Gebäude den allgemeinen Gebäudetypus, jedoch nicht das exakte Erscheinungsbild. Die erste kursächsische Landesaufnahme zeigt zwar bereits etwas mehr Einzelheiten, doch lassen sich auf dem Schlossgelände lediglich der Bergfried und die Ringmauer eindeutig erkennen. Das Gebäude mit der Bezeichnung „thor“ könnte das neue Haus darstellen, während das alte Haus fehlt. Allerdings geben Darstellungen anderer Burgen und Schlösser in der ersten kursächsischen Landesaufnahme nicht immer den tatsächlichen Zustand wider, sodass keine verlässlichen Rückschlüsse auf den Gebäudebestand um 1615 gezogen werden können. Im Vorwerk selbst lassen sich neben den schematisch angedeuteten Bauten die umliegenden Gärten erkennen, ebenso wie die außerhalb des eigentlichen Kernbereichs gelegene Schäferei. Als Straßen sind die heutige Thalheimer Straße, Zwönitzer Straße und die Straße (Schloßberg) nach Stollberg dargestellt.
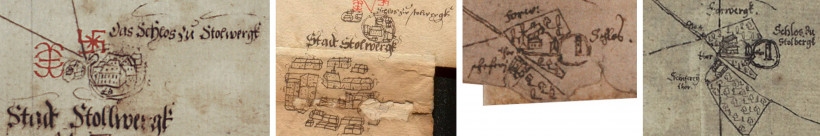
Abbildung 2: Schlossdarstellungen zwischen 1570 und 1615 (v. l. n. r. 1570[P1570b][P1570a] 1615[P1615c][P1615b])
Detaillierter als diese Karten sind die nie umgesetzten Pläne Simon Hoffmans [P1615a], die höchstwahrscheinlich den wiederaufgebauten Umfang des neuen Hauses bzw. Amtshauses zeigen (siehe Übersicht), und der allgemein bekannte Riß Wilhelm Dilichs [P1626_1629].
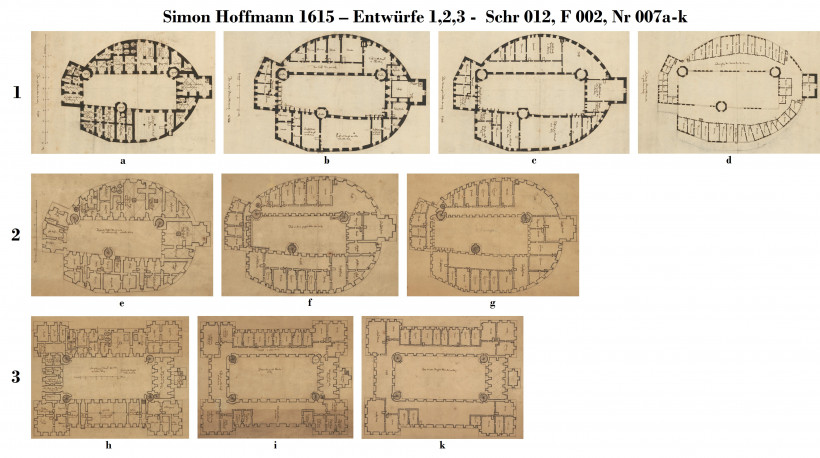
Abbildung 3: Schloss Stollberg - geplanter Umbau nach Simon Hoffmann um 1615 (nie umgesetzt) [P1615a]
Um jedoch einen präzisen Einblick in die tatsächlichen Gegebenheiten der damaligen Zeit zu gewinnen, ist eine Untersuchung der verstreuten Inventarlisten im Sächsischen Hauptstaatsarchiv unerlässlich. Diese Dokumente wurden mit Blick auf die Situation des Vorwerkspächters und des Amtschössers zusammengetragen, verglichen und in Inventargruppen (siehe Anhänge – Inventare) eingeordnet. Während die Vorwerkspächter größtenteils mithilfe der Inventare nachzuvollziehen sind, erforderte die Identifizierung der Amtsschösser eine eingehende Analyse der Archivalien des Finanzarchivs. Der Abgleich beider Forschungsansätze erlaubt es schließlich, die Wohnverhältnisse auf Schloss Stollberg zwischen 1564 und 1701 genauer zu beleuchten.
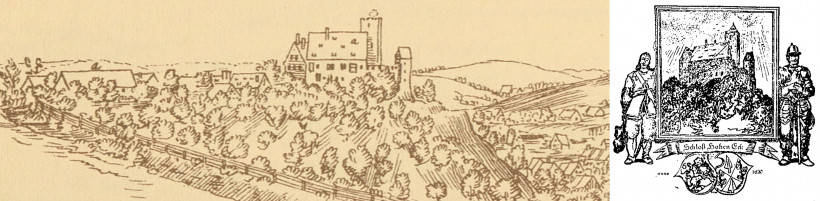
Abbildung 4: Schloss Stollberg nach Wilhelm Dilich um 1626/29[P1626_1629] und spätere abgeleitete Zeichnung (S. 5[L2002], S. 121 [L1922], S. 17[L1993] und Stadtarchiv Stollberg Bildarchiv Nr. 20001832)
Geschichtliche Entwicklung
Entwicklung zwischen dem Kauf Kurfürst August 1564 und dem Brand des neuen Hauses 1602
Laut dem Erbbuch gehörten um 1591 sowohl das alte als auch das neue Haus zu den Hauptgebäuden des Schlosses: „ein aldt Schloß / Alt und Neu Haus“ [Q1591a-1].
Zwischen 1564 und 1602 wurde nach der Inventargruppe 1 vor allem das „neue Haus“ im Schloss Stollberg als Wohnstätte genutzt. Es ist nicht anzunehmen, dass die gesamte Anlage – einschließlich der älteren Bausubstanz – wie vielfach in der Literatur beschrieben zu einem Jagdschloss umgebaut wurde. Vielmehr lässt die Quellenlage darauf schließen, dass neben dem „alten Haus“ lediglich ein „neues Haus“ errichtet wurde, das fortan das „alte Haus“ als Hauptwohnstätte ablöste. Im „alten Haus“ wurden ab diesem Zeitpunkt vorwiegend die geräumigen Keller und Gewölbe als Lagermöglichkeiten genutzt. Amtsschösser und Vorwerkspächter waren zu dieser Zeit in Personalunion tätig.
Regelmäßige Bautätigkeiten am Schloss lassen sich durch den kurfürstlichen Baumeister Hans Irmisch nachweisen. Am 19.07.1571 sollte er nach seiner Genesung mit dem Amtschösser von Stollberg über Ausbesserungsarbeiten verhandeln (S. 68 [L1937]). 1573 fertigte er ein ausführliches Gutachten zum Schloss an (S. 69 [L1937]), und im selben Jahr kamen Ziegel für kleinere Instandsetzungen zum Einsatz (S. 70 [L1937]). Vierzehn Jahre später, 1587, ist von weiteren kleineren Baumaßnahmen am Schlossturm die Rede (S. 70 [L1937]). 1597 führte Hans Irmisch erneut Bauarbeiten durch, wobei er schließlich im Schloss verstarb (S. 65 u. 81 [L1937]).
Ein einschneidendes Ereignis ereignete sich am 06.06.1602 (S. 8 [L2018a]): Das „neue Haus“ brannte nieder, wodurch die oberen Geschosse zerstört wurden. Nach dem Inventar [S1618] standen danach nur noch die Räumlichkeiten im Erdgeschoss zur Verfügung: „1. In der Torstube“, „2. Im Schreibstüblein oder Gewölbe daran“, „3. Unter dem Torhaus“ und „5. In der Küche“. Das neue Haus war nach dem Brand zunächst unbewohnbar, sodass der Amtsschösser Wolf von Breitenbach seine Geschäfte nicht mehr in dessen Räumlichkeiten ausüben konnte (Schmidt II – S. 114 [L1976_1978]).
Entwicklung zwischen dem Brand des neuen Hauses und dem Dreißigjährigen Krieg
Das „neue Haus“ war nach dem Brand von 1602 (wieder)aufgerichtet und wurde zunächst bis um 1608 überwiegend zu Verwaltungszwecken des Amtes Stollberg (Amtsstube, Unterbringung des Amtsschössers) genutzt. Ab jenem Zeitpunkt – als der Vorwerkspächterposten nicht mehr von derselben Person wie das Schösseramt bekleidet wurde – diente das neue Haus zusätzlich als Wohnstätte des nun eigenständigen Vorwerkspächters.
Der erste bekannte Vorwerkspächter, der nicht zugleich Schösser war, ist Elisabeth von Nitzschwitz. Von 1608 bis 1614 teilte sie sich mit dem Amtsschösser Melchior Blüer die Räumlichkeiten im nach 1602 wiederaufgebauten Schloss. Die wenigen bewohnbaren Räume (insgesamt nur „zwei Stuben und fünf Kammern“) lagen in der Hauptsache im „neuen Haus“, während im „alten Haus“ zu dieser Zeit vor allem Keller und Gewölbe als Lagerräume dienten (siehe Inventarlisten).
Elisabeth von Nitzschwitz nutzte einen Großteil jener Wohnflächen im neuen Haus und belegte laut Quellen mehrere Stuben und Kammern, was bei Schösser Blüer allmählich zu Unmut führte. Er bewohnte mit seiner Familie fast nur die kleine Stube „über den Ambtsstuben und Thor“ und beschwerte sich schließlich beim Kurfürsten Johann Georg.
Als nach 1614 Hans Hermann von Weißenbach die Pacht übernahm, wurde ihm von vornherein deutlich weniger Raum im neuen Haus eingeräumt als seiner Vorgängerin. Infolgedessen entstand erst ab diesem Zeitpunkt die Notwendigkeit, neben der Schösserwohnung (Amtsstube) im neuen Haus auch wieder das „alte Haus“ verstärkt zu Wohnzwecken auszubauen. Vorher schienen die bestehenden Räumlichkeiten im um 1564 errichteten neuen Haus weitgehend auszureichen, sodass das alte Haus größtenteils nur als Lagerbereich (Keller, Gewölbe) genutzt wurde.[Q1610]
In den Inventaren des neuen Hauses von 1584 bis 1602 [S1584][S1597][S1602] erscheint der jeweilige Schösser gleichzeitig als Vorwerkspächter; er nutzte Amtsstube und Wohnräume im neuen Haus, während das alte Haus lediglich sporadisch belegt war.
Ab 1608 gab es jedoch eine Trennung dieser Ämter, sodass der Schösser weiterhin im „neuen Haus“ (ab 1609 auch „Amtshaus“ genannt) residierte – nun jedoch selbst nur unter eingeschränkten Platzverhältnissen [1610]. Die Pächter des Vorwerks mussten daher ab 1614 verstärkt das alte Haus herrichten und ausbauen, um genügend Wohnraum zu schaffen. Einen guten Einblick über die Bautätigkeiten in diesem Zusammenhang gibt der Baubericht und Kostenanschlag von 1615 über die Räumlichkeiten "auf der rechten Hand über den Kellern und Gewölben" (=altes Haus). Nach diesem werden mehrere Stuben/ Kammern neu hergerichtet, Fenster vergrößert, neue Kamine angelegt, neue Aborte an die Außenmauer angebracht und eine Küche im Gewölbe angelegt. [Q1615] Es kann vermutet werden, dass die Umbaupläne Simon Hoffmanns von 1615[P1615a] aufgrund des geschilderten Wohnraummangels angefertigt wurden. Wie die späteren Inventare der Räumlichkeiten der Vorwerksbesitzer auf dem Schloss zeigen, fand jedoch nie ein kompletter Neubau nach den Umbauplänen statt. Wahrscheinlich hat man sich aufgrund stetig klammer Kassen gegen einen Neubau und lediglich für eine Renovierung/ Umgestaltung des alten Hauses entschieden.
Dies erklärt, weshalb sich die älteren Inventare (1584–1602), die jeweils beim Vorwerkspächterwechsel angefertigt wurden, vor allem mit dem neuen Haus befassen, während die Inventare ab 1626 vermehrt das alte Haus in den Mittelpunkt rücken. Zusätzlich kann vermutet werden, dass sich ab der Ämtertrennung die Bezeichnung "Amtshaus" für das 1602 wiederaufgebaute "neue Haus" durchgesetzt hat. Die Umbenennung ist also eher auf die neuen Gegebenheiten im Schloss zurückzuführen, als auf einen kompletten Neubau an der Stelle des neuen Hauses. Auch aufgrund des Vergleiches der Inventarlisten vor 1602 mit den Plänen von 1615 nach dem Brand ist eher von einem Wiederaufbau auszugehen.
Die einzige erhaltene Darstellung aus dieser Zeit ist die Federzeichnung Wilhelm Dilichs aus dem Jahr 1626 (siehe oben) [P1626_1629]. Vergleicht man die Inventarlisten um das Jahr 1626 mit der Aufnahme Dilichs, ergibt sich ein stimmiges Gesamtbild. Schmidt vermutete, dass die Zeichnung den Zustand vor dem Brand im Jahr 1602 zeigen müsse und 1626 ein Großteil der Schlossgebäude noch immer in Schutt und Asche gelegen habe (Schmidt II – S. 114 [L1976_1978]). Anhand der Inventarlisten ist jedoch von einem anderen Zustand auszugehen:
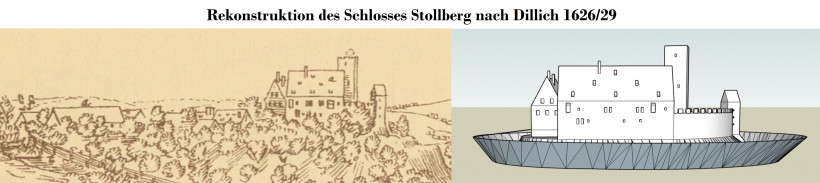
Abbildung 5: Vergleich Dilich[P1626_1629] und eigene Rekonstruktion um 1626/29 (eigene Darstellung)
Bei dem rechten Schlossgebäude, dessen Längsseite dargestellt ist, handelt es sich um das „alte Haus“, welches sich 1626 [S1626] im Besitz des Vorwerkspächters befand. Die Räumlichkeiten werden im Anhang in der Inventargruppe 2a ausführlich beschrieben. Links daneben befindet sich das Amtshaus bzw. die Amtsstube („neues Haus“), die zu dieser Zeit neben dem „kleinen Turm“ (bei Dilich ganz rechts) und dem Bergfried („Turm“) im Besitz des Amtschössers waren (siehe Inventargruppe 1). Weiterhin befand sich um 1626 neben dem eigentlichen Vorwerk auf der linken Seite (siehe Inventargruppe 3a) ein kleines, bei Dilich nicht sichtbares Haus hinter der Amtsstube, welches ebenfalls dem Vorwerkspächter gehörte. Dieses Haus enthielt eine große gewölbte Küche.

Abbildung 6: Schloss Stollberg und Vorwerk um 1615 (erste kursächsische Landesaufnahme)[P1615b]
Zerstörungen im Dreißigjährigen Krieg laut [Q1632]
Nach der zeichnerischen Darstellung Wilhelm Dilichs und den Inventarangaben um 1626 trat mit Beginn des Dreißigjährigen Krieges eine erneute Zäsur in der Geschichte von Schloss und Vorwerk Stollberg ein. Vor diesem Krieg scheint der Zustand der Gebäude und des Inventars nicht schlecht gewesen zu sein, denn es wird in den Quellen von verschiedenen Renovierungsarbeiten und Instandsetzungen in jüngerer Vergangenheit berichtet (fol. 433r [Q1632]).
Zwischen 1632 und 1650 jedoch wurde Schloss Stollberg stark in Mitleidenschaft gezogen, unter anderem durch die Einquartierung kaiserlicher und schwedischer Truppen, die Zerstörung von Gebäuden und die Plünderung des Inventars. So beklagte beispielsweise Angija Metzschin bereits 1633 Kriegsschäden und verlorenes Inventar (fol. 419r [Q1632]). Immer wieder ist von Kriegsgewalt, Einlagerungen, Ausplünderungen und Abnahmen die Rede (fol. 515r–517v [Q1632]). Auch das Vorwerksinventar blieb hiervon nicht verschont, wie etwa die Hinweise auf Plünderungen (fol. 464r [Q1632]) zeigen. Die Kriegsschäden im Jahr 1633 können mit dem Einfall des Feldmarschalls Heinrich von Holk im August 1633 in Verbindung gebracht werden, bei welchem die Stadt Stollberg für zunächst 700 fl. gebrandschatzt und danach in Brand gesteckt worden ist (S. 307 [L2018c]).
In den 1640 entstandenen Inventaren von Vorwerk und Schloss sind die Kriegsschäden ausführlich dokumentiert und werden dort eindeutig „Keyserlichen und Schwedischen Völckern“ zugeschrieben (fol. 518r - 528v [Q1632]). Nahezu alle Gebäude wurden stark beschädigt und das Inventar stark zerstört (fol. 523r ff. [Q1632]). Auch der Tierbestand, etwa an Rind- und Schafvieh, war erheblich geschrumpft.
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Vorwerk und Schloss vor allem in den Jahren um 1634 und 1639 von kaiserlichen und schwedischen Truppen verwüstet wurden (fol. 149 [V1640b]). Dieses Ausmaß an Zerstörung prägte in der Folgezeit die Entwicklung von Schloss Stollberg nachhaltig und bestimmte den weiteren Verlauf der Bautätigkeiten sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im 17. Jahrhundert.
Entwicklung nach dem Dreißigjährigen Krieg bis 1701
Nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges werden Schloss und Vorwerk Stollberg in den Quellen von 1672 als baufällig beschrieben. Zu den genannten Gebäuden zählen unter anderem Brau- und Malzhaus, das Badestubenhaus im Bienengarten, die Schäferei, das Wohnhaus im Vorwerk, ein großer Schafstall, ein neuer Stall auf der auswärtigen Seite, ein Schuppen, das „Schloßgebäude/große Gebäude“, ein Schäfer Viehhaus sowie ein Kälberstall [Q1672].
Aufgrund der kriegsbedingten Belastungen hatte Kurfürst Johann Georg I. bereits im Jahr 1632 zur Aufrechterhaltung seiner Armee 35.750 Reichstaler von Rudolph von Vitzthum zu Apolda und Heinrich Hildebrand von Einsiedel geliehen und dafür das Stollberger Vorwerk verpfändet. Die folgenden Kriegsplünderungen und fehlenden Abgaben führten zu jahrzehntelangen Streitigkeiten um die Zinszahlungen (vgl. [Q1644_1653]). Erst 1670 konnte eine endgültige Einigung erzielt werden, in der eine abschließende Vergleichssumme festgelegt und die Ansprüche der beteiligten Erben mit mehreren Ratenzahlungen abgegolten wurden. Das Vorwerk ging anschließend zurück in den Besitz der kurfürstlichen Rentkammer und wurde von Johan Georg Zimmerman und dem Schösser Johann Jacob Drummer verwaltet [Q1670].
Bis 1681 befand sich das Vorwerk („Forwerg“) Stollberg „auf Rechnung“ unter der Leitung des staatlich eingesetzten Verwalters Michael Blüher. In jenem Jahr wurde diese Verwaltungsform beendet, und der Landesherr – der Kurfürst – verpachtete das Vorwerk für sechs Jahre an den Privatpächter Leutnant Carl von Goldsteinen [V1681][Q1681]. Michael Blüher bewohnte bis dahin die sogenannten „Logiamenter auffm hohen Hause“ (altes Haus) des Schlosses. In den Schriftstücken jener Zeit finden sich Hinweise auf diverse Baumaßnahmen, die auf den schlechten Zustand der Gebäude schließen lassen. Beispielsweise waren Schlossfenster noch vom Krieg beschädigt, und viele Dächer bedurften dringend einer Reparatur. Das Inventar selbst wird im Dokument auf vier Seiten angeführt und umfasst sämtliche Schloss- und Vorwerksgebäude, welche im Jahr 1681 als „Churfl. Sächel. Schloß Stolbergk“ bezeichnet werden [V1681].
Im Jahr 1693 erhielt der Schösser Gottlob Pohlen das gesamte Schloss mitsamt Kellern, Gewölben, Stuben, Kammern und Böden sowie die Vorwerksgebäude (darunter das Malz- und Brauhaus, den Bienengarten, das Viehhaus und die Schäferwohnung) übergeben [V1693b][V1693c]. Aus den Quellen geht hervor, dass in den Jahren davor bereits einige Baumaßnahmen am Schloss und Vorwerk stattgefunden hatten [Q1698c]. Beim Wechsel von Gottlob Pohle zu Christian Friedrich Hausenmann ändert sich zudem die Amtsbezeichnung von „Schösser“ zu „Amtmann“ (fol. 111v [Q1698c]).
Größere Mengen Bier wurden im Schlosskeller gelagert, die Schösser bzw. Vorwerkspächter wie Gottlob Pohle selbst gebraut hatten. In früheren Zeiten lagerten mitunter auch städtische Brauer ihr Bier im Schloss. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts untersuchte die Stadt Stollberg, ob Pohle möglicherweise weit größere Mengen Bier als gestattet braute und im Umland vertrieb [Q1698_1699].
Da das verpachtete Vorwerk um 1698 nur noch unzureichende Erträge für die Landesherrschaft abwarf, wurde ab jenem Jahr über einen Verkauf bzw. eine Vererbung des kompletten Vorwerks mit allen landesherrlichen Rechten beraten. Geplant war, in diesem Zuge auch die bislang geforderten Naturalabgaben und Frondienste in feste Geldleistungen umzuwandeln. Die Stadt Stollberg bekundete Interesse am Kauf von Vorwerk und Schloss, während der amtierende Schösser aus Eigeninteresse wohl versuchte, den Verkauf zu verhindern. Schließlich wurde das Vorwerk 1702 mitsamt Schlossgebäude, weitläufigen Gartenparzellen, Wiesen, Teichen und den verbundenen Rechten an den Amtmann „Gottlob Friedrich Nester“ veräußert [Q1698b]. Der Wegfall der Frondienste beschleunigte das Verfallen der Schloss- und Vorwerksgebäude immens.
Einen genaueren Eindruck vom baulichen Zustand vermittelt eine Beschreibung der Schlossgebäude in den Quellen (fol. 10r und fol. 66r [Q1698b]): Das Schloss verfügte über 10 Stuben, 11 Kammern, 7 Böden, 7 Gewölbe, 3 Keller und 2 Küchen. Die Mauern wiesen teils eine Stärke von 5 bis 6 Ellen auf, und eine hohe Ringmauer mit tiefem Graben und Wall umgab das gesamte Areal. Zu den Vorwerksbauten gehörten außerdem Malz-, Brau- und Viehhaus, ein Backkeller, ein Bienenhaus, Kuh- und Schafställe, ein „Grummet Schuppen“ (Heu), vier Scheunen und eine Schäferei.
Gebäudeübersicht
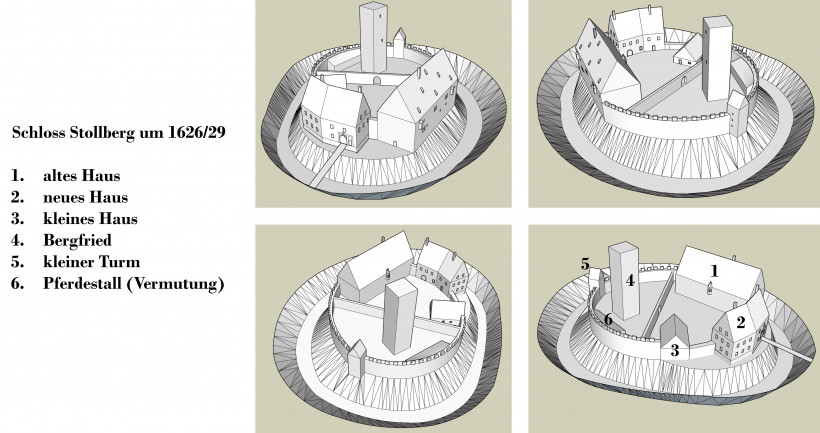
Abbildung 7: Schloss Stollberg um 1626/29 (eigene Darstellung)
altes Haus
"altes Haus" [Q1573][Q1591a-1][S1597][S1602]/ " Im Schloß Im eingange, uff der rechten Handt uber den Kellern und gewelben"[Q1615] / "Am rauen oder großen Haus im Eingang zur rechten Hand"[S1626] bis [S1640b] / "großes Haus"[S1670a] / "großes Gebäude" [Q1672] / "hohes Haus"[V1681] / "Niederhaus"[V1701] / Schloss Gebäude[Q1790]
Ein ausführliches Gutachten des kurfürstlichen Baumeisters Hans Irmisch aus dem Jahr 1573 [Q1573] gibt einen aufschlussreichen Überblick über die Bausubstanz dieses Gebäudes. Laut Irmisch besaß das alte Haus zu jener Zeit eine Länge von 63 Ellen (entspricht bei der Dresdner Elle von 1610 mit 56,5 cm etwa 35,60 Metern) und eine Breite von 25 Ellen (ca. 14,13 Meter). Bereits damals war das Gebäude renovierungsbedürftig: Ein undichtes Dach führte zu Wasserschäden, verfaulten Balken, mangelhaften Fußböden, Decken und Fenstern (die kaum verglast waren), fehlenden Türen und Schlössern sowie nicht funktionstüchtige Kachelöfen. Zudem beklagte Irmisch die unzweckmäßige Raumaufteilung, sodass umfangreiche Reparatur- und Umbauarbeiten erforderlich schienen [Q1573].
Im Jahr 1615 wurde das alte Haus erneut instand gesetzt. Nach einer Beschreibung jener Zeit [Q1615] befanden sich „im Schloß im Eingange, uff der rechten Hand über den Kellern und Gewölben“ unter anderem im:
- untern Geschoß
- eine große Stube
- eine kleine Stube
- 2 Kammern (mit bereits verlegten Balken)
- Gewölbe (daraus soll eine Küche gemacht werden)
- Über solchem Gemächern
- eine Stube
- eine Kammer
Eine Schlosskapelle war 1626 bereits nicht mehr vorhanden: "In der ersten Stuben oben der gewesenen Kirchen"[S1626]. Die Schloßkapelle war zum Wohngebäude in Hofrichtung angebaut ("als Erker mit einer hohen Spitze" S. 112 [L1976_1978_1]) und enthielt neben dem Altar, einen Predigtstuhl, Kruzifix, zwei Mannstühle, fünf Weiberstühle und eine "eißerne Pfanne zu Sieben Lichten". (siehe Inventargruppe 1)
Aus dem Inventar von 1626 [S1626] ergibt sich eine Aufteilung in insgesamt 5 Ebenen:
- Keller ("ein großer langer Keller und ein ebenso großes und langes Gewölbe darüber")
- Gewölbe (evtl. "Silberkammer", zwei hintere Gewölbe (ein langes), ein vorderes Gewölbe auch "Zehrgarten" genannt (wahrscheinlich für Speisevorräte) -> siehe Inventare [S1584][S1597][S1602]
- "Im anderen Geschoss über den Kellern und Gewölben" (erste OG) (In der ersten Stube, Stüblein (Nebenzimmer), Küche, Kammer(n) mit Secret, Flur / Saalbereich)
- "drittes Geschoss" (zweite OG) (Ehemalige Kapelle / „Bohrkirchen“, Erste Stube, Kammer für erste Stube, Zweite/ Andere Stube, Kammer für zweite Stube, Dritte Stube (Große Stube), Kammer für dritte Stube, Flur/ Saal)
- Dachboden/ Speicher (geteiltes Boden- oder Speicherareal)
neues Haus
"neues Haus" [Q1573][Q1591a-1][S1597][S1602] (erbaut nach 1563)/ "Schlosse"[S1584] / nach 1609 "Amtshaus" (S. 114[L1976_1978_1])/ Amtsstube[S1626] bis [S1640b], [S1670a], [V1701][Q1736a] / Ambtshaus(1730[V1699], 1742[Q1742]) / Amtsgebäude [Q1754b] / kleines Schloss[Q1790][Q1796] / Kornhaus (fol 7r [Q1808b]) / Amtsfrohnveste ([Q1814])
Bereits im Baugutachten von Hans Irmisch aus dem Jahr 1573 [Q1573] wird das neue Haus erwähnt und im Jahr 1584 als "in wohlgebautet" beschrieben. Die vorliegenden Inventare des Gebäudes, das später als Amtsstube diente, sind in vier Fassungen erhalten (1584 [S1584], 1597 [S1597], 1602 [S1602] sowie unmittelbar nach dem Brand 1602 [S1618]). Sie belegen, dass sich Raumaufteilung, Möblierung und Ausstattung zwischen 1584 und 1602 kaum änderten. Zwar kam es offenbar zu Verschleiß einiger Einrichtungsgegenstände (z. B. Hirschgeweihen, Tischen oder Schubbetten), aber auch kleinere Instandsetzungen sind dokumentiert. So wurde etwa 1597 am neuen Haus renoviert [S1597][S1602].
Da das neue Haus laut den Inventaren keinen Keller aufwies, ist davon auszugehen, dass es tatsächlich keine ältere Bausubstanz an dieser Stelle gab. Auch ein späterer Querschnitt des wiederaufgebauten Amtshauses bestätigt das Fehlen eines Kellers [P1857]. Im Erdgeschoss des neuen Hauses befand sich durchgehend ein Gewölbe [P1615a]. Die erwähnte gewölbte Küche in den Inventaren des neuen Hauses [S1584][S1597][S1602] ist wahrscheinlich identisch mit der Küche des alten Inventares ""Auf der anderen Seite unter dem kleinen Haus hinter der Amtsstube (große gewölbte Küche)" und befand sich wahrscheinlich nicht im eigentlichen neuen Haus, sondern im "Kleinen Haus hinter der Amtsstube"[S1626]. Das kleine Haus hinter der Amtsstube und das neue Haus werden wahrscheinlich in den Inventaren des neuen Hauses als ein Objekt behandelt.
Am 2. Juni 1602 wurde das neue Haus durch einen Brand schwer beschädigt. Zwischen 1606 und 1609 erfolgte ein Wiederaufbau an gleicher Stelle (S. 9 [L2018a]). In den Quellen taucht es nunmehr als „Amtsstube“ auf [S1626]. Um 1614 stand im teilweise wiedererrichteten Gebäude ("wieder auffgerichten Schloß gebeuden") laut [Q1610] lediglich eine begrenzte Anzahl bewohnbarer Räume zur Verfügung (2 Stuben und 5 Kammern). Auch das Inventar [S1618], das kurz nach dem Brand erstellt worden zu sein scheint, listet nur noch Räumlichkeiten im Erdgeschoss ("In der Thorstuben", "Im Schreib Stublein oder gewölbe dorann", "Unterm Thorhaus" und "In der Küchen"), da die oberen Geschosse vorerst unbewohnbar blieben.
Einen Plan für einen umfassenden Schlossneubau ließ Simon Hoffmann 1615 anfertigen (S. 307 [L2018c]; [P1615a]), wobei seine Entwürfe vier Ebenen („erste Grunt“, „andere Grunt“, „driete Grunt“, „vierte Grunt“) vorsahen. Das Erdgeschoss des neu aufgebauten Amtshauses stimmt laut diesem Plan in seiner Aufteilung weitgehend mit dem späteren Riß von 1798[P1798c] und dem Situationsplan von 1815 überein [P1815a]. Darüber hinaus lassen sich die Räume aus den älteren Inventaren (vor dem Brand 1602) nahezu vollständig den von Hoffmann genannten Ebenen zuordnen ([S1584][S1597][S1602]). Vermutlich handelte es sich bei dem Wiederaufbau somit nicht um einen völlig neuen Bau, sondern eher um die Reparatur und den teilweisen Umbau des „neuen Hauses“. Im Detail ist von folgender Aufteilung der vier Ebenen auszugehen:
4 Ebenen:
- Erdgeschoss "erste Grunt" (Torstube, Schreibstübchen oder Gewölbe daran, Einfahrt ("Unter dem Torhaus"), Küche, Kanzlei, zwei Kammern, Flur)
- erstes Obergeschoss "andere Grund" (gemalte Stube [Herrenzimmer des Kammerherrn und des Herrn Jägermeister], Gemach von Fürst Christian von Anhalt und Herzog Adam Wenzel von Deschen, große hölzerne Kammer dabei, In der großen weißen Kammer auf dem Saal)
- zweites Obergeschoss "driete Grunt" (Im Gemach des Kurfürsten von Sachsen, Im Schlafgemach, Flur, Im Gemach der Kurfürstin von Sachsen, Auf dem Gang oder im Kämmerlein, In der Schlafkammer der Kurfürstin von Sachsen)
- Dachgeschoss "vierte Grunt" (Im Gemach von Christoff Kohlreutter, Im Gemach der kurfürstlichen Leibjungen von Adel, Auf dem Boden über dem Gemach von Meinem gnädigen Herrn, Auf dem Kornboden daneben, Im Frauenzimmer das vorher die große Stube genannt wurde, Flur, In der Schlafkammer des Frauenzimmers, Speisesaal/ Hofstube, In der Kammer des Kammerherrn und Jägermeisters, In der ersten Truchsess Kammer, In der anderen Truchsess Kammer)
Mit diesem Wiederaufbau setzte sich das neue Haus bzw. spätere Amtshaus in seiner Funktion als zentraler Verwaltungs- und Wohntrakt des Amtsschössers im Schloss Stollberg fort.
kleines Haus hinter den Amtsstuben
"kleines Haus hinter den Amtsstuben" (, "uff der andern Seiten [Gegenüber dem alten Haus]", Amtsstuben = neues Haus)(fol. 384v[S1626]) "Holzgewölbe" (fol. 72r [Q1797_1808]) "in dem Bierkeller dem Backhause gegenüber ... Theil des alten Schlossgebäudes über den großen Bierkeller" (fol. 75r [Q1808b])
Aus späteren Plänen [P1798c][P1815a][P1857] geht hervor, dass es sich dabei um denselben Bau handeln könnte, der später als Holzschuppen für den Amtsfrohn (1815) bzw. Thatsbestandseffectenbehältniss und Baugerätheschuppen (1857) bezeichnet wurde (siehe Kapitel „zwischen 1815 und 1862“).
Wahrscheinlich ist dieses Gebäude älter als das „neue Haus“, da es unterkellert ist und sich darüber ein Gewölbe befindet, was [P1857] zufolge dem grundsätzlichen Aufbau des alten Hauses ähnelt. Vermutlich gehörte das kleine Haus ursprünglich zur älteren Bausubstanz der „Staleburc“ (vor dem Bau des neuen Hauses). Im Jahr 1626 [S1626] wird im dortigen Gewölbe eine Küche erwähnt.
Bergfried
"dorm" [Q1573], "Auf dem Turm" und "am Turm im Schloße"[S1584][S1597] [S1602], Turm[Q1790]
Aus dem Gutachten von Hans Irmisch im Jahr 1573 [Q1573] geht hervor, dass dieser Turm vor dem Pferdestall stand, welcher wiederum an der Schlossmauer errichtet war. Es ist deshalb sehr wahrscheinlich, dass es sich bei diesem „Turm“ um den Bergfried handelte. Der Bergfried wurde vor 1761 vom Amtmann Liebe abgetragen, um den Platz sinnvoll als Garten nutzen zu können.[Q1790]
kleiner Turm
"Über den kleinen Turm im Gemach von D. Kohlreutter und D. Salmuth"[S1584][S1597] [S1602][V1681]
Laut Schmidt beherbergte er das Amtsgefängnis (die Amtsfronfeste) und die Marterkammer (S. 113 [L1976_1978_1]). Im 18. Jahrhundert erhielt der kleine Turm eventuell den Namen „Hoheneck“ (S. 113 [L1976_1978_1]). Auf einem Bild aus dem Jahr 1790 ist er noch deutlich zu erkennen.
Pferdestall
"Stall" - "welcher hinder den dorm an der mauer stehett" [Q1573]
In den Quellen wird der Pferdestall als „Stall […] welcher hinder den dorm an der mauer stehett“ beschrieben [Q1573]. Er befand sich demnach hinter dem Bergfried und direkt an der Schlossmauer.
Weitere potentielle Gebäude im und am Schloß
- Backhaus (im Schloß)[V1567]
- Badestube (ab 1584 im Schloss erbaut - wahrscheinlich im Garten[V1608] -> siehe auch[Q1591a-3]"der Badtstuben garten", davor wahrscheinlich im Vorwerk gelegen)[V1584][V1598a][V1608][V1614]
3. Schloss Stollberg und (Kammer)gut Hoheneck zwischen 1702 und 1815
Geschichte nach dem Verkauf an Nester bis zum zur Errichtung des neuen Amtshauses auf dem Schlossgelände
Geschichtliche Entwicklung
Im Besitz von Gottlob Friedrich Nester zwischen 1702 und 1736
Am 03.04.1702 verkaufte August der Starke das komplette Vorwerk sowie das gesamte Schloss Stollberg an den Akzisrat Gottlob Friedrich Nester [Q1731]. Im Zuge einer Überprüfung am 21.09.1731 stellte sich die Frage, ob diese Veräußerung angesichts des einstigen Festungscharakters des Schlosses (bezeichnet als Fortalitium) rechtmäßig sei. Letztlich wurde die „Abtretung“ jedoch anerkannt und bestätigt. Aus den zugehörigen Unterlagen geht hervor, dass es im Schloss weiterhin Amtsstuben für die Beamten gab und die Anlage selbst mit Graben, Wall und Wehrmauern ausgestattet war. Allerdings war der wehrhafte Zustand längst nicht mehr zeitgemäß und lohnte keine umfassende Sanierung, da das Schloss bereits in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand war. Seit dem Verkauf an Nester wird zudem der Name „Hoheneck“ für das Vorwerk in den Quellen verwendet [Q1731].
Bereits seit 1699 besaß Nester das Vorwerk und Schloss Stollberg – laut Unterlagen „samptlichen Stollbergischen Schloß, Forwergks-Schäfferey und andere Gebäude“ (fol. 2r [Q1752c]) – und wurde in den Pachtverschreibungen „unterm Praedicat eines Amtmanns“ aufgeführt. Auch wenn Nester damit als „Ambtmann“ bezeichnet wird, standen ihm nicht alle Schlossgebäude unmittelbar zur Verfügung: Teile des Areals, insbesondere das eigentliche Amtsgebäude, dürften weiterhin vom Amtschreiber Samuel Sehm genutzt worden sein [Q1699]. Im Jahr 1713 wird in den Akten außerdem der Neubau einer Stube in der Frohnveste (eventuell der kleine Turm - nicht sicher) erwähnt und es ist von Baumaßnahmen am Röhrwasser für ebenjene Frohnveste die Rede [Q1699]. Das Amtsgebäude selbst wird im Jahr 1730 als „im höchsten Grad baufällig“ beschrieben.[Q1699]
Bereits in [Q1701] wird zudem angedeutet, dass allein das Vorwerk in Privateigentum übergehen sollte, während das Schloss (vermutlich das Amtshaus) im Besitz der kurfürstlichen Kammer verbleiben und weiterhin als Verwaltungszentrum dienen sollte [Q1701]. In der Archivalie [V1702a] findet sich dann ein Auszug über den Verkauf des „Schloß/ Forwegs/ Schäfferey und andere Gebäude mit zugehörigen Grundstücken, erblich an Ambtmann daselbst Gottlob Friedrich Nestern“ für 10.000 fl., wobei Nester weiterhin einen jährlichen Erbzins für das steuerfreie Brauen zu entrichten hatte. Einzelheiten zu diesem Vorgang und zu weiteren Verkäufen im Amtsbereich Stollberg listet eine Tabelle in [V1702b] auf, etwa zur Veräußerung „Der Schloß und Forwergs Gebäude wie auch zugehörigen Feldern und Wiesen zu Stollberg“.
Im Jahr 1732 richtete der Vorwerkspächter Michael Ebert im sogenannten Viehhaus (seiner Wohnung) eine neue Schenkstätte ein. Die brauende Bürgerschaft Stollberg warf ihm vor, hierzu nicht berechtigt zu sein, da dies sowohl die Landes- und Polizeyordnung als auch das städtische Brauereiprivileg verletze und zudem der Stadtwirtschaft schade (fol. 2r [Q1732]). Der Eigentümer von Schloss und Vorwerk, Gottlob Friedrich Nester, entgegnete, er habe beim Kauf im Jahr 1702 das Recht auf Abbrauen, Ausschank und Ausschrotung von zehn steuerfreien Bieren erworben, weshalb Eberts Ausschank rechtmäßig sei. Im Verfahren wurde auch eine bereits seit 1709 bestehende Schenke auf der Schäferei des Vorwerks erwähnt, deren Errichtung damals zu Streit mit der brauenden Bürgerschaft geführt hatte, jedoch vom Leipziger Schöffenstuhl als rechtmäßig anerkannt worden war. Der Schäferei-Pächter Hans Georg Ahlert widersprach 1732 der neuen Ausschankgenehmigung im Viehhaus, da dieser Ausschank nur etwa 50–60 Schritte von seiner bestehenden Schenke entfernt lag [Q1732].
Der zu diesem Zeitpunkt amtierende Amtmann Daniel Gottfried Lieben ist seit mindestens 1732 nachweisbar; seine Tätigkeit auf dem Schloss als Beamter lässt sich bereits ab 1728 belegen (fol. 18r [Q1732]).
Weiterhin findet sich in den Quellen ein Hinweis auf den früheren Vorwerksbesitzer Nester, der nach 1702 angeblich wegen „gänzlichen Mangel aller Frohndieste“ rund 37 Häuser auf Kammergut-Grund errichten ließ; diese Neusiedler hatten Erbzins zu zahlen und Frohntage zu leisten (fol. 15r [Q1808a]).
Nach dem Tod Nesters im Jahr 1736 bis zum Rückkauf des Gutes "Hoheneck" durch die sächsische Kammer im Jahr 1752
Gottlob Friedrich Nester (bis dahin Besitzer des Vorwerks, Amtmann, „Commissions Rath“ und „Accis Rath“) verstarb um 1736 und schied damit als Amtmann aus [Q1736b]. Sein Nachfolger wurde Daniel Gottfried Lieben, der bereits seit acht Jahren als Beamter diente und nun die Justizadministration im Amt Stollberg übernahm. Der langjährige Amtsverwalter Samuel Seihmen (Sehm), „bey etilichen zwanzig Jahren“ im Dienst, blieb weiterhin als Verwalter im Amt tätig und erhielt zusätzlich die Gesamtpacht (Finanzeinnahmen) des Amtes Stollberg [V1736][Q1736a]. Nach Nesters Tod scheint es Überlegungen gegeben zu haben, dass Amthaus außerhalb des Schlosses zu verlegen (eventuell aufgrund von Streitigkeiten mit Nesters Erben). Der neue Amtmann Liebe setzt sich für den Verbleib auf dem Schloß ein: "Bittet der Ambtmann allern unterthänigst, Das Ambten Hauß wie zeithero auf daisen Schloße zulaßen".[Q1736a]
Zwischen 1736 und 1752 befand sich das Vorwerk vermutlich im Besitz der Erben Gottlob Friedrich Nesters [Q1752c]. Ab 1743 könnte Michael Lasche die Verwaltung des Vorwerks übernommen haben (fol. 8r, 28v [Q1753]). In der sächsischen Finanzverwaltung löste zu jener Zeit der „Amtsverwalter“ den bisherigen Amtsschösser ab, während der „Amtmann“ die leitende Funktion innehatte und für die Gerichtsbarkeit verantwortlich war.
Aus Unterlagen von 1736 geht hervor, dass sich vor dem Amtshaus nach Nesters Tod noch immer eine Brücke und Graben befand, sodass entsprechende Baumaßnahmen notwendig waren: „Ist wegen Erbauung der Brücken zum Schloße und der eingegangen Dachen etwas Röhrholz nebst 4. Schindelbaumen nötigh“ [Q1736a]. Auch die Wasserleitung zum Schloss war „aufs euserste eingegangen“ und bedurfte neuer Röhren. In demselben Jahr ist zudem eindeutig belegt, dass man das ehemalige „Schloss Vorwerk zu Stollberg“ seit der Übernahme durch Nester „Hoheneck“ nannte [Q1736b].
Bereits 1702 hatte Nester das Vorwerk Stollberg („Hoheneck“) zusammen mit einem scheinbaren Recht auf steuerfreies Brauen erworben. Da er jedoch erheblich mehr Bier braute und in den umliegenden Dörfern unversteuert absetzte, drohten dem Landeshaushalt Steuerausfälle. Jahrelange behördliche Untersuchungen (1724–1741) folgten, um Nachforderungen geltend zu machen und eine Rückabwicklung des Vorwerk-Verkaufs zu prüfen [Q1736b].
Im Jahr 1742 erhielten Amtmann Liebe und Amtsverwalter Sehm die Genehmigung, die Geschäfte des Amtes Stollberg für weitere sechs Jahre bis 1748 zu führen [Q1742][V1742]. Sollte Sehm versterben, ging die gesamte Pacht des Amtes automatisch an Liebe über, der im Amtshaus innerhalb des Schlosses wohnte und dieses teils aus eigenen Mitteln instand halten musste (z. B. Dach- und Mauerreparaturen) Das Amtshaus befand sich allgemein in einem schlechten Zustand, wurde jedoch von Liebe teilweise saniert. Im Jahr 1742 musste er aus eigener Tasche zusätzlich ein feuerfestes Archiv im Amtshaus errichten [Q1742]. Nachdem Sehm tatsächlich um 1746 verstorben war, übernahm Lieben 1748 für sechs Jahre in einer neuen Pachtverschreibung neben der Gerichtsbarkeit auch die Finanzverwaltung und blieb als alleiniger Amtspächter im Schloss [Q1748][V1748]. Die am Schlussstein des Eingangs des Amtshauses neben der Jahreszahl 1564 eingemeißelte Jahreszahl 1748 ist wahrscheinlich auf die Reparatur- und Umbautätigkeiten unter Liebe um das Jahr 1748 zurückzuführen (siehe Riß [P1798c]).
1752 kam es schließlich zum Konkurs der Nester-Erben. Infolge einer gerichtlichen Zwangsversteigerung kaufte die sächsische Kammer das Gut Hoheneck (ehemals Vorwerk) wieder zurück, das nun wieder als „Kammergut Hoheneck“ bezeichnet wurde. Von da an verpachtete man das Anwesen erneut (fol. 42v [Q1752c]). Schloss und Vorwerk befanden sich damit wieder vollständig im Besitz der sächsischen Kammer.
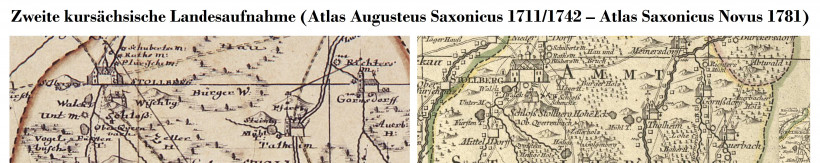
Abbildung 8: Zweite kursächsische Landesaufnahme (links 1711/1742[P1711_1742] "Schloß", rechts[P1781] "Schloß Stollberg Hohe Eck" und "Schloß Schenke")
Zwischen dem Rückkauf des Kammerguts im Jahr 1752 und dem Umzug des Amtshauses im Jahr 1771 in das sogenannte „Bertholdische Haus“ in der Stadt
Ein Dokument aus den Jahren 1754 bis 1763 [Q1754_1763] nennt verschiedene Bautätigkeiten an den Schloss- und Vorwerksgebäuden. Demnach wurde regelmäßig das Röhrwasser ausgebessert, da es im Winter bisweilen völlig versagte. Auch die äußere Hauptmauer des Schlosses war in einem so schlechten Zustand, dass ein Pfeiler zur Stabilisierung nötig wurde. Darüber hinaus verzeichnet das Dokument kleinere Baumaßnahmen wie Pflasterarbeiten (vermutlich im Schlosshof) sowie Ausbesserungen am Pferdestall.
Im Jahr 1752 wurde der Häusler und Strumpfwirker Johann Gottfried Uhlich(en) als Subjectum (Beamter) für die neue Land-Accis-Einnahme (Verbrauchssteuerstelle) im Vorwerk Hoheneck eingesetzt, um den aufkommenden Warenhandel (etwa mit Brot und Garn) ordnungsgemäß zu besteuern [Q1752b]. Ungefähr zur selben Zeit findet sich in einem weiteren Dokument der Hinweis auf die Einrichtung einer Zoll- bzw. Mautstelle („Beygleith“) in der Vorwerks-Schenke, um sogenannte „Gleits-Unterschleiffe“ durch Fuhrleute zu unterbinden. Uhlich sollte neben der Land-Accise auch das „Beygleith“ der Fuhrleute erheben und erhielt dafür an seinem Haus an der Straße eine Zolltafel [Q1754a].
Michael Lasche war vor 1753 (möglicherweise bereits seit 1743, fol. 8r [Q1753]) Pächter des Guts Hoheneck. 1753 musste er dieses aufgrund einer verloren gegangenen Ausschreibung an Johann Gottlob Fischer übergeben, der jedoch bereits 1754/1755 wegen ausstehender Zahlungen wieder abgesetzt wurde. Das Vorwerk befand sich zu jener Zeit in einem allgemein schlechten Zustand: Das Wohnhaus war undicht, und mehrere Gebäude bedurften dringend einer Reparatur.
Bemerkenswert ist außerdem ein Hinweis auf einen durch Amtmann Liebe zugemauerten Keller. Vermutlich handelte es sich dabei um einen Keller im Schloss (evtl. Bierkeller neben Amtshaus), der zuvor vom Vorwerk aus zugänglich war. Da nun kein alternativer Lagerraum zur Verfügung stand, verschlechterten sich Bier und andere Vorräte für die Vorwerksbewohner entsprechend (fol. 6v [Q1753]).
Nachdem Johann Gottlob Fischer das Vorwerk massiv heruntergewirtschaftet hatte (fol. 87v [Q1754b]) und ein „verwüstetes Forwergk“ hinterließ, fiel das Kammergut Hoheneck an Amtmann Daniel Gottfried Lieben zurück. Dieser erhielt im Jahr 1754 eine Pacht über weitere neun Jahre für das Amt und das Kammergut. Nach Liebens Tod im Jahr 1761 – er war zu diesem Zeitpunkt 71 Jahre alt und hatte seit 1728 im Amt Stollberg gedient – übernahm Adam Fraugott Feustel übergangsweise als Amtsverweser die Geschäfte (fol. 169r [Q1754b]). Der eigentliche Nachfolger wurde Liebens Sohn Friedrich Amadeo Daniel Lieben (Jura-Studium, zuvor Amtsactuarius in Annaburg), den der alte Amtmann bereits zu Lebzeiten als Adjunctus für die Justizverwaltung in Stollberg vorgesehen hatte.
Aus denselben Unterlagen geht hervor, dass Daniel Gottfried Lieben die ungewöhnlich hohen Stuben im Amtsgebäude bemängelte, welche mit acht Ellen (ca. 4,5 m) viel Heizmaterial und hohe Instandhaltungskosten verursachten (fol. 78v [Q1754b]). Mehrfach wird zudem eine Schenke als fester Bestandteil des Kammerguts Hoheneck erwähnt (gelegentlich als eingegangen beschrieben). Im Schloßgraben werden außerdem Ahornbäume genannt (fol. 79r [Q1754b]).
Im Jahr 1758 erhielt der Häusler Christian Fritzschen ein ungefähr 100 × 10 Schritte großes, wertloses Stück der alten Gebirgischen Straße beim Kammergut Hoheneck in Erbpacht, unweit der steinernen Brücke [Q1758]. Diese Übergabe steht im Zusammenhang mit dem Verkauf der alten, baufälligen Schenke (samt Gärtchen und Scheune) auf dem Kammergut an ebenjenen Christian Fritzschen (Leineweber), jedoch ohne Schankgerechtigkeit, da das Gebäude mittlerweile zu marode für eine neue Schenke war. Stattdessen errichtete man um 1759/1760 auf dem Vorwerksgelände eine neue Schenke an der Stelle eines alten Schafstalls, dessen Mauern teilweise wiederverwendet wurden.
Um 1760 ließ Amtmann Daniel Gottfried Liebe auf einem wüsten, sumpfigen Platz hinter dem Eyergarten mehrere Häusler ansiedeln. Diese mussten neben einem jährlichen Erbzins auch Frohn- und Handdienste leisten. In einem darauf folgenden, umfangreichen Schriftwechsel diskutierten die Beteiligten, ob die neu angelegten Grundstücke beim Weiterverkauf oder Ausbau von bestimmten Steuern (wie Schock und Quatember) befreit seien. Der Grund für diese Unsicherheit lag darin, dass das betreffende Gelände einst Rittergutsboden war (in Zeiten der Schönberger wurden hier vier Ritterpferde gestellt). Letztlich entschied man jedoch, dass Steuern erhoben werden müssten, weil die ehemalige Rittergutsherrschaft mit der Umwandlung zum kurfürstlichen Amt (durch Kurfürst August) erloschen war und damit die alten Privilegien entfielen. Nach längerem Hin und Her einigte man sich darauf, dass für alle seit 1760/61 in Hoheneck neu errichteten Häuser zwar die alten Abgaben (Erbzins, Frohndienste) anerkannt blieben, sie sich aber zusätzlich an den Landessteuern beteiligen mussten [Q1768_1792].
1763 wurde die Pacht für das Amt Stollberg und das Kammergut Hoheneck für weitere neun Jahre, also bis 1772, an Amtmann Friedrich Amadeo Daniel Lieben verlängert [V1763]. Infolge des Siebenjährigen Krieges wird im Jahr 1762 von verspäteten Abrechnungen, geringen Einnahmen und hoher Belastung berichtet (fol. 1v [Q1763]).
In den Pachtverschreibungen war festgehalten, dass der Amtmann für kleinere Reparaturen am „Schloß- und Amtsgebäude“ selbst aufkommen musste, während größere Umbauten und Hauptreparaturen der Zustimmung durch das Kammer-Kollegium bedurften und vom Landesherren bezahlt wurden. Außerdem war vorgeschrieben, dass das Inventar nach Ablauf der Pacht in gleichwertigem Zustand zu übergeben sei. Der jährliche Pachtzins betrug in dieser Zeit rund 4.100 Taler. Der Pächter verwaltete zudem die Justiz, erhob Steuern und Abgaben, musste aber bestimmte „reservierte“ Einkünfte unmittelbar an die Rentkammer abführen.
Um 1770/1771 fiel die neu erbaute Schenke einem Brand zum Opfer und wurde hernach erneut aufgebaut. Auch andere Vorwerksbauten (etwa das Hirten- und das Schäferhaus) erlitten dabei Schäden [Q1768_1792]. Da das Hirten- und das Schäferhaus offenbar schon 1771 weder benötigt noch genutzt wurden – Hirte und Schäfer bewohnten inzwischen andere Räume des Vorwerks – dachte man über deren Veräußerung nach [Q1771]. Durch den Umzug der Amtsstube in die Stadt verlor die Schenke einen wesentlichen Teil ihrer Kundschaft, weil viele Reisende, insbesondere die Beamten, dem Vorwerksgelände fernblieben [Q1758_1808]. Die Schlossgelände verfiel ab sofort zusehends.
Im Jahr 1771 ist das „alte Schloss“ bereits größtenteils eingestürzt. Eine Reparatur des Schlossareals (u.a. Amtshaus) wäre aufgrund des schlechten baulichen Zustands der Gebäude mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden gewesen. Aus diesem Grund mietete sich das Amt Stollberg in das sogenannte Bertholdische Haus (benannt nach Bürgermeister Berthold) in Stollberg ein. (fol. 30v [Q1797_1808])
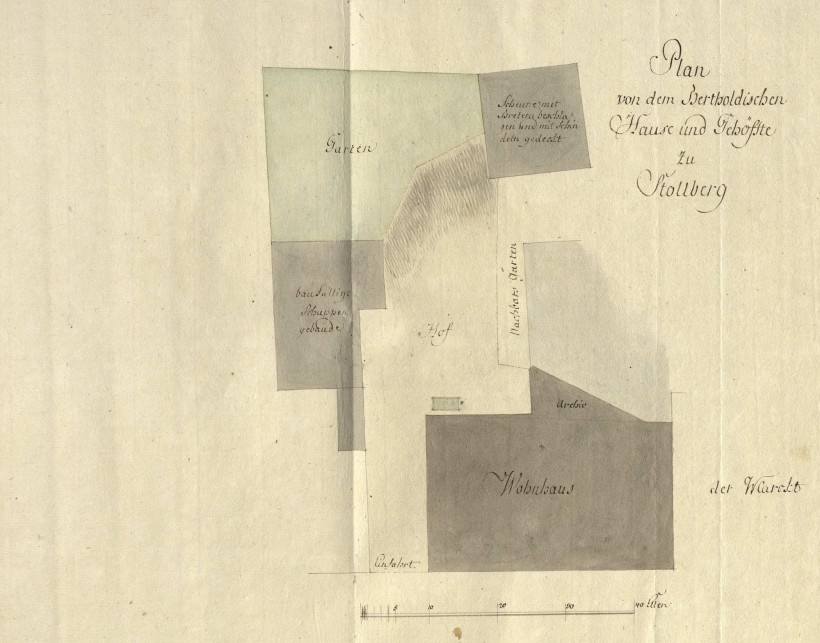
Abbildung 9: Plan von dem Bertholdischen Hause und Gehöfte zu Stollberg um 1798[P1798b]
Zwischen dem Umzug des Amtshauses im Jahr 1771 vom Schloss in das sogenannte „Bertholdische Haus“ in der Stadt und dem erneuten Umzug in das „Rößlerische Haus“ am Markt im Jahr 1802
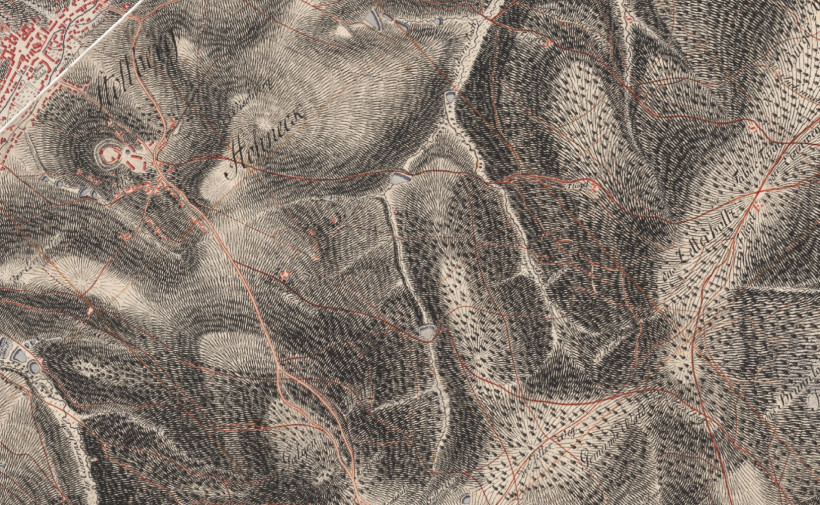
Abbildung 10: Meilenblatt Berliner Exemplar Blatt 200 um 1790 [P1790a]
1778 wurde die Pacht des Amtes Stollberg und des Kammerguts Hoheneck an Amtmann Friedrich Amadeus Daniel Lieben erneut verlängert, diesmal für sechs Jahre bis 1784 [V1778]. Die vorhergehende Pachtverschreibung ist nicht erhalten, dürfte aber den Zeitraum 1772 bis 1778 abgedeckt haben [V1772]. Um 1783 verstarb Amtmann Liebe („letztverstorben“ [Q1790]), und das Kammergut ging an Johann Christoph Schubert über, der bereits seit 1769 als Unterpächter unter Liebe tätig gewesen war. Schuberts Stiefvater, Johann Christian Haase, war zuvor nach dem Vorwerkspächter Johann Gottlob Fischer ebenfalls Unterpächter des Hauptpächters Daniel Gottfried Lieben (fol. 44v [Q1796]).
In dieser Zeit befanden sich die Wirtschaftsgebäude des Vorwerks in einem schlechten Zustand („sehr ruiniert“). Das Wohnhaus war klein und baufällig, und sowohl Brand- und Weinhaus als auch Schweineställe waren schon vor einiger Zeit abgerissen und nicht ersetzt worden. Darüber hinaus geriet Schubert in Konflikt mit der Stadt Stollberg, da er im Vorwerk umfangreichen Bier- und Branntweinausschank betrieb und dem städtischen Braugewerbe erheblich Konkurrenz machte.
Ein zweiter Streit betraf die Nutzung dreier Gärten am und im leerstehenden Schloss: zweier Gärten außerhalb der Ringmauer vor dem Tor und eines Gartens innerhalb der Ringmauer. Aus den Unterlagen geht hervor, dass sich im innenliegenden Garten einst der alte Bergfried und eine „Hofmauer“ befanden, die vor dem Tod von Daniel Gottfried Lieben (vor 1761) komplett abgetragen wurden, um den Schlosshof als Garten zu nutzen (S. 277 [V1790a]; fol. 6v [Q1796]). Zur Anlage der beiden Gärten vor dem Tor hatte Liebe den Schlossgraben 14 Ellen (7-8m) aufschütten lassen. Um 1784 lagen diese Flächen voller Schutt und Steine, während im Garten innerhalb der Ringmauer eine eingestürzte Mauer des „Schloss Gebäudes“ (altes Haus) einen großen Teil des Areals bedeckte.
Das frühere Amtshaus wird in jenen Quellen als „kleines Schloss“ bezeichnet. Der „kleine Garten“ außerhalb der Ringmauer weist rund 30 tragbare Obstbäume (plus jüngere Bäume) auf, während der „große Garten“ etwa einen halben Fuder Heu einbringt. Im Schlosshof (innerer Garten) kann dagegen „kaum ein Dresdner Viertel Korn ausgesät werden.“ Johann Christoph Schubert erhielt schließlich die Erlaubnis, gegen Zahlung einer weiteren Pacht die Gärten zu nutzen – da die Beamten (z. B. der Amtmann sowie Justiz- und Rentbeamte) inzwischen nicht mehr in Hoheneck, sondern in Grünhain oder im neuen Amthaus am Markt ansässig waren.
Ebenso durfte Schubert das uneingeschränkte Schankrecht weiterhin ausüben. Er verwendete das ehemalige Amtshaus (nun „kleines Schloss“) aufgrund seines fehlenden Wohnsitzes in Stollberg als Lagerraum. Vom „kleinen Schloss“ führten Türen direkt in den Schlosshof sowie in den darin gelegenen Garten, und Schubert äußerte den Wunsch, eben diesen Gartenteil selber zu pachten, damit er das Schlosstor verschließen und sein Inventar im kleinen Schloss schützen könne [Q1790].
Im 18. Jahrhundert eignete sich die Stollberger Familie Höckner ein brachliegendes Reststück der 1732/34 verlegten alten Heer- und Handelsstraße („die Schlucht“ – Bereich der heutigen Zwönitzer Straße 3 bis 3c) an, das jedoch infolge der Straßenverlegung in das Eigentum des kursächsischen Kammerguts Hoheneck gefallen war. Die Dresdner Finanzbehörde entschied am 9. Februar 1784 endgültig, das Grundstück zu Michaelis desselben Jahres wieder in das Kammergut einzugliedern. [Q1783]
Mit dem Tod von Amtmann Liebe um 1783 endete erneut die Personalunion von Amtsmann und Vorwerkspächter. In diesem Zusammenhang erfolgte im September 1784 die Zusammenlegung der Justizverwaltung des Amtes Stollberg mit jener des Amtes Grünhain. (fol. 30r [Q1797_1808]) Ein unmittelbarer Nachfolger für Liebe scheint nicht zur Verfügung gestanden zu haben. 1784 und 1785 übernahm offenbar Amtmann Dietrich vom Amt Grünhain zusätzlich die Amtsgeschäfte in Stollberg [Q1790]. Erst später erscheint ein gewisser Christian Gottlob Kampens, der für viele Jahre als eigentlicher Nachfolger Liebes fungierte ([V1778]).
Im Jahr 1771 war die Amtsstube vom Amtshaus im Schloss in das "Bertholdische Haus" am Markt verlegt worden (fol. 30v [Q1797_1808]). Etwa 1785 erwog man jedoch, die Amtsstube wieder ins Schloss zu verlegen, wovon die Formulierung „der künftig aufs Schloß wieder zu verleihenden Amtsstube“ zeugt [Q1790]. Der Umzug um 1785 wurde wie sich später zeigen wird, noch nicht ausgeführt.
Gegen Ende der Pachtzeit von Christoph Schubert am Vorwerk Hoheneck kam es zu Auseinandersetzungen um die Vergütung einzelner Verbesserungen, Baulichkeiten sowie für das zurückgelassene Heu und Grummet. Ab 1796 übernahmen Johann Michael Reinholden und dessen Sohn Johann George Reinholden die Pacht für zwölf Jahre bis 1808 (fol. 166 ff. [Q1808a]). Da die neuen Vorwerkspächter ihr Rindvieh nicht mehr im Amtsforst Zellerholz weiden durften, um Neuanpflanzungen zu schützen, entstanden ihnen hohe Fütterungskosten durch Stallfütterung. Für die Übergabe von Schubert an die Pächter Reinholden wurde 1796 ein eigenes Inventar erstellt [V1796a].
Infolge von Unwettern (u. a. Hagel) kam es zudem zu Missernten, woraufhin die Familie Reinholden um Pachtminderung bat. In den Dokumenten wird das Schloss mehrfach als „eingefallen“ oder „eingegangen“ beschrieben („alten eingefallenen Schloß“ fol. 13v, „eingegangenes Schloss“ fol. 73r [Q1808a]). Die Amts-Expedition (Amtsstube) im Städtchen Stollberg war 1795 nach wie vor nur mietweise untergebracht (fol. 16r [Q1808a]). Das Wohnhaus des Vorwerks wurde 1786 neu errichtet (fol. 70v [Q1808a]).
Der Mietvertrag für die Amtsstube im Bertholdischen Haus in der Stadt wurde zuletzt im Jahr 1797 um sechs Jahre bis 1803 verlängert. Aufgrund des schlechten Bauzustands des Gebäudes – es galt als „äußerst schlecht, baufällig und feucht“, zudem lag das Archivgewölbe teilweise unter benachbarten Grundstücken – sollte es danach jedoch nicht weiter genutzt werden. (fol. 9r [Q1797_1808])
In den Jahren 1797/98 begann daher die Suche nach Alternativen für ein neues Amtshaus. Im Jahr 1797 zog Landbaumeister Frank in Erwägung, das Amtshaus („Justiz und Amtsexpedition“) von der Stadt zurück auf das Schlossgelände zu verlegen. (fol. 43r [Q1797_1808])
Der Bauanschlag über das „kleine Schloss“ (neues Haus) gibt detaillierte Einblicke in die geplanten Umbautätigkeiten in den einzelnen Gebäuden und Räumen. (fol. 46r [Q1797_1808])
Für die Planung wurde ein Riss mit den vorgesehenen Umbauänderungen an den Schlossgebäuden angefertigt (Sub A entspricht dem kleinen Schloss, Sub B dem Holzgewölbe). (fol. 72r [Q1797_1808])
Der um das Jahr 1798[P1798c] entstandene Riss des Schlossgebäudes wurde vermutlich im Zusammenhang mit den im Bauanschlag sehr detailliert aufgelisteten Umbautätigkeiten zum geplanten Amtshaus auf dem Schlossgelände erstellt. Er stellt lediglich den geplanten, jedoch nie umgesetzten Zustand dar. Die schwarzen Mauern und Linien zeigen den tatsächlichen Bestand des Gebäudes, während die roten Linien die geplanten Änderungen gemäß dem umfangreichen Bauanschlag wiedergeben. Das zweite Obergeschoss war als neue Etage vorgesehen, existierte zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht und wurde daher vollständig in Rot dargestellt. Die Frontalansicht des neuen Hauses ist im Plan sowohl in seinem aktuellen Zustand als auch mit der geplanten zusätzlichen Etage dargestellt.
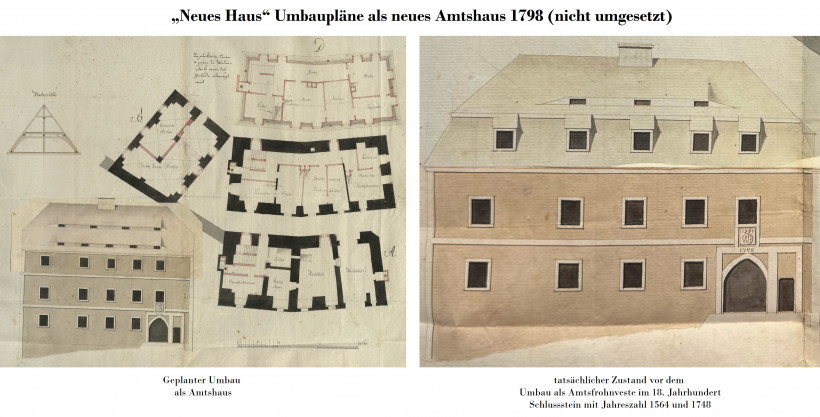
Abbildung 11: "Neues Haus" Umbaupläne als neues Amtshaus um 1798 (nicht umgesetzt)[P1798c]
Im Jahr 1797 existierten auf dem Schlossgelände lediglich noch zwei Gebäude, die im Riss nummeriert sind: – Sub A – das sogenannte kleine Schloss (neues Haus) – Sub B – das vom Vorwerkspächter zur Lagerung von Holz und Reißig genutzte Gewölbe (Holzgewölbe bzw. kleines Haus)
Das bisherige „Holzgewölbe“ (Sub B) war als zukünftiges Archivgebäude vorgesehen. In dem kleinen Haus, das bisher zur Lagerung von Holz und Reißig diente, wurden 1797 unter dem Fußboden kellerartige Öffnungen („Kellerlöcher“) festgestellt. Man vermutete zunächst darunterliegende Keller. Nach mehreren Untersuchungen kam man jedoch zu dem Schluss, dass es sich um alte „Schießlöcher“ handeln müsse und dass das gewölbte Gebäude vermutlich ein Überrest der ehemaligen Schlossbefestigung sei. (fol. 4v [Q1797_1808]) Im späteren Verlauf desselben Dokuments wird jedoch erneut von sich unter dem Archivgebäude befindlichen Kellern gesprochen. (fol. 47r [Q1797_1808])
Das „kleine Schloss“ (Sub A) sollte im Erdgeschoss (Parterre) eine Durchfahrt, die Amtsstube, eine Küche sowie eine Vorratskammer für den Aktuar enthalten. In der ersten Etage war jeweils eine Kammer und eine Stube für den Aktuar, den Rentbeamten und den Justizbeamten vorgesehen, zudem eine Abtrittsstube. (fol. 1r [Q1797_1808])
Das Rentamt benötigte darüber hinaus Lagerkapazitäten für 700 Scheffel aufgeschüttetes Getreide. Diese Anforderungen konnten jedoch weder der Dachboden des kleinen Schlosses (Sub A) noch jener über dem geplanten Archivgebäude (Sub B) erfüllen. Sollte im kleinen Schloss zusätzlich ein Dienstbeamter untergebracht werden, müsste gemäß dem Plan (siehe Riss Nummer D) eine weitere Etage sowie darüber ein Schüttboden errichtet werden. (fol. 1v [Q1797_1808])
Das alte Schloss (altes Haus) war im Jahr 1797 bereits größtenteils abgetragen. Die darunterliegenden Gewölbe existierten jedoch noch und man überlegte diese Gewölbe abzutragen und für das geplante Archivgebäude im "Holzgewölbe" zu nutzen. (fol. 5r [Q1797_1808])
Aufgrund der hohen zu erwartenden Kosten ließ das Geheime Finanzkollegium den geplanten Schlossumbau zurückstellen. Stattdessen entschied man sich im Jahr 1801 für den Kauf und den Umbau des Rößlerischen Hauses am Markt in Stollberg. Im Jahr 1802 wurde dieses Gebäude schließlich zum Amtshaus ausgebaut. (fol. 131r [Q1797_1808])
Vom Rößlerischen Haus existieren mehrere Risse, die den Zustand des Gebäudes als Amtshaus dokumentieren. (fol. 22r [Q1797_1808])
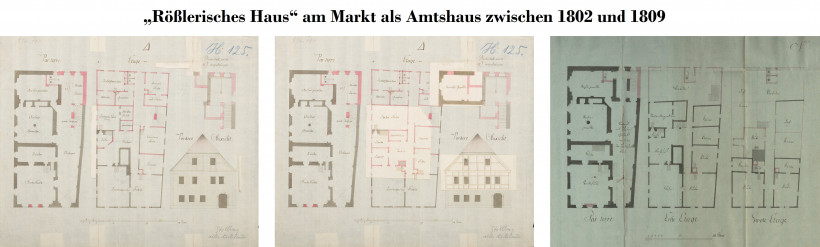
Abbildung 12: Rößlerisches Haus am Markt als Amtshaus zwischen 1802 und 1809 (v. l. n. r. [P1815d][P1815e][P1798a])
Die Vorwerkspächter Johann Michael Reinholden und Johann George Reinholden führten ihre Pacht des Kammerguts Hoheneck nicht bis 1808 fort, wie ursprünglich vereinbart. Bereits vor diesem Zeitpunkt (spätestens 1807) trat Christian Lebrecht Kreyßel als neuer Pächter an. Er bewarb sich 1808 um eine Verlängerung der Pacht bis 1814 („Abgabe Gebot bei der Versteigerung“ / „Termino Licitationis“), doch erhielt stattdessen Wilhelm Adolph Gestewitz den Zuschlag und pachtete das Kammergut bis 1814 [V1808].
Bereits in den Jahren 1730–1790 gab es Beschwerden der Stadt Stollberg gegen das Kammergut Hoheneck wegen Verletzung des Bierzwangrechts durch Bierverkauf in die Amtsdörfer. Im Jahr 1808 berief die Königliche Landesregierung erneut Vergleichsverhandlungen ein. Das Kammergut Hoheneck bot an, Bier nur ab Hof zu verkaufen, während Stollberg ein vollständiges Verbot des Bierverkaufs (Ausschrotens) in die Dörfer forderte. Ergebnis: Es kam zu keiner Einigung; der Streit wurde vertagt und sollte gerichtlich entschieden werden [Q1808c].
Das Vorwerk befand sich zu dieser Zeit in schlechtem Zustand: Es gab Sanierungsbedarf bei den Gebäuden, die Dächer waren undicht, und bei der Übergabe kam es wegen des Inventars zu Streitigkeiten. In den Folgejahren war der Pächter Gestewitz wiederum von Missernten und den Auswirkungen der Napoleonischen Kriege (Einquartierungen, Lieferungen an die Truppen) betroffen, was zu Pachtgeld-Rückständen führte. 1814 versuchte er, die Pacht um weitere 6 oder 9 Jahre zu verlängern [Q1808b].
Gebäudeübersicht
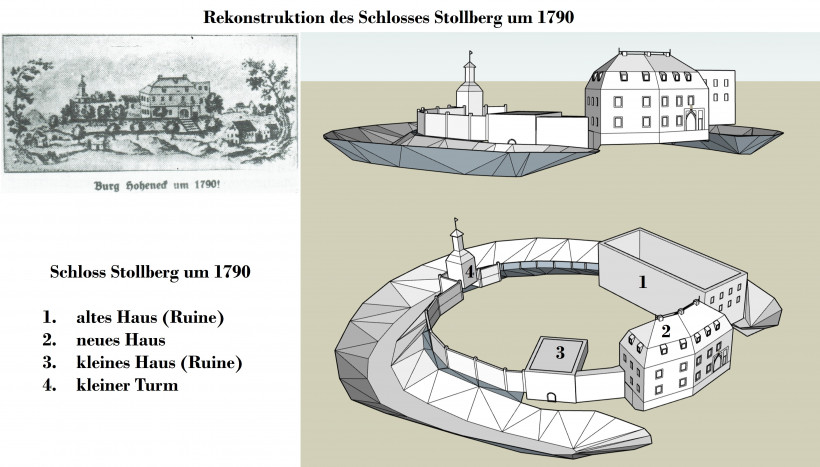
Abbildung 13: Rekonstruktion des Schlosses Stollberg um 1790 (3D Modelle eigene Darstellung - "Burg Hoheneck um 1790" aus S. 7 [L2002] und Stadtarchiv Stollberg Bildarchiv Nr. unbekannt)
altes Haus
Nach dem Kauf sämtlicher Schloss- und Vorwerksgebäude durch Gottlob Friedrich Nester im Jahr 1702 verlor das alte Haus seine letzte Funktion. Nester selbst residierte bereits seit etwa 1699 als Amtmann im Amtshaus (oder auswärts), und auch die nachfolgenden Vorwerkspächter wählten das eigens im Vorwerk errichtete neue Wohnhaus als ständigen Wohnsitz. Damit blieben die Wohnräume des alten Hauses – schon seit Beginn des 17. Jahrhunderts kaum noch genutzt – endgültig unbewohnt und verfielen zusehends. Zum fortschreitenden Niedergang trug überdies die Aufhebung der traditionellen Frondienste bei: Die von Nester angesiedelten Häusler konnten mit ihren geringen Fronleistungen das Arbeits- und Instandhaltungspensum der früheren Fronpflichtigen nicht annähernd ersetzen. Bereits vor 1784 war deshalb ein Teil der Mauer des alten Hauses eingestürzt und bedeckte Teile des inneren Schlossgartens (S. 277 [V1790a]; fol. 6v [Q1796]). Auf dem Berliner Meilenblatt von 1790 ist die Ruine zwar noch eingezeichnet, doch wurde sie mit dem Neubau des Amtshauses ab 1809 vollständig abgetragen; die dabei gewonnenen Ziegel dienten unmittelbar als Baumaterial für das neue Amtsgebäude. Bereits 1797 sind nur noch Teile des ehemaligen alten Hauses vorhanden. (fol. 5r [Q1797_1808])
neues Haus
Das neue Haus diente von seiner Fertigstellung 1574 bis 1771 ohne Unterbrechung als Amtshaus. In dieser langen Nutzungszeit erfolgten lediglich Notreparaturen; 1771 war die Bausubstanz jedoch derart geschwächt, dass eine umfassende Sanierung wirtschaftlich nicht mehr vertretbar schien. Man verlagerte daher die Amtsstube vom "neuen Haus" im Schloss in das "Bertholdische Haus" am Markt.
Eine Beschreibung von 1790 nennt das frühere Amtshaus im Schloss noch als den einen erhaltenen Flügel, „welcher auch zugleich den Eingang in den Schloßhofen und innern Garten in sich begreift“ (fol. 6r [Q1796]). Daraus lässt sich schließen, dass der zweite Flügel – das alte Haus – damals bereits weitgehend zur Ruine geworden war. Insgesamt wird das „Schloße zu Hoheneck“ um 1790 als verfallen geschildert; die Räume des neuen Hauses dienten nur noch als Lager, etwa für Getreide.
Nach dem Stadtbrand von 1809 begann man, auf dem Schlossgelände ein neues, zehn Fenster breites Amtshaus mit Rentamt zu errichten; die Kosten beliefen sich auf 12 026 Taler. Der Bau umfasste eine Dienstwohnung für den Amtmann, eine Aktuarswohnung im Dachgeschoss sowie Speicher für das Zinsgetreide. Als Baumaterial verwendete man unter anderem Ziegel der abgetragenen Schlossruine (das ehemalige alte Haus) [L1824] [L1841]. Mit den eigentlichen Arbeiten wurde 1812 begonnen; 1815 ist von einem drei Jahre zuvor gestarteten Neubau die Rede (fol. 1v [Q1815]), und 1819 war das Gebäude vollendet. Es entstand unmittelbar neben beziehungsweise auf Teilen des Standorts des alten Hauses: „Seit beinahe 4 Jahren, wo der Bau des Amthaußes auf dem ehemaligen Schloss Platze zu Stollberg bei Hoheneck begonnen“ (fol. 39v [Q1815]). Auch die Sächsische Kirchengalerie bestätigt: „An der Stelle des alten Schlosses ward 1814 ein schönes Gebäude errichtet, worin das Königliche Justiz- und Rentamt sich befindet“ [L1842-1].
Das von Kurfürst August errichtete neue Haus wurde nach dem Umzug des Amtes im Jahr 1771 nicht mehr als Verwaltungssitz benötigt und in den 1800er-Jahren zur Amtsfrohnveste (Gefängnis) umfunktioniert [L1824] [L1841]. Bereits 1808 heißt es, die Frohnveste sei „nunmehro […] mit ins Kornhauß eingebauet worden“ (fol. 7r [Q1808b]). In diesem Zusammenhang wurden die angrenzenden Gärten dem Vorwerk zugeschlagen; lediglich ein kleines Gärtchen verblieb der Frohnveste.
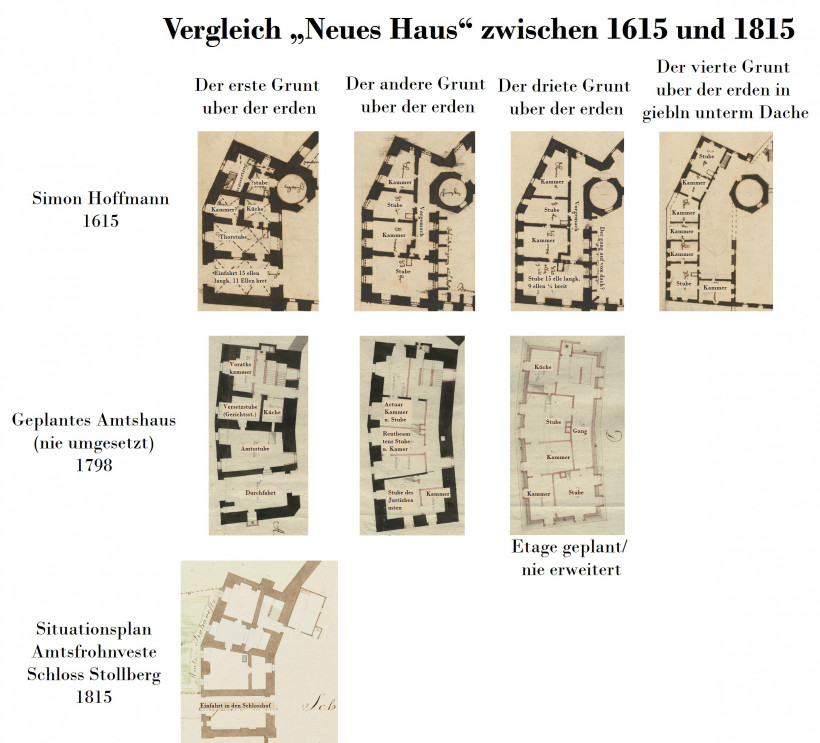
Abbildung 14: Vergleich "Neues Haus" zwischen 1615 und 1815 (1615[P1615a], geplantes Amtshaus 1798[P1798c], Schloss Stollberg 1815[P1815a])
kleines Haus hinter der ehemaligen Amtsstube (jetzt Amtsfrohnveste)
Gegenüber dem Backhaus des Vorwerks lag ein großer Bierkeller, der bei schlechtem Wetter regelmäßig unter eindringendem Wasser litt. Das darüber stehende kleine Gebäude wird ausdrücklich als Teil des „alten Schloßgebäudes“ bezeichnet, dessen Gewölbe wegen der Feuchtigkeit „eine neue Dachung“ benötigte ("der Theil des alten Schloßgebäudes über den großen Bierkeller bedarf auch zur Sicherung des Gewölbes eine neue Dachung" - fol. 75r [Q1808b]). Auf dem Berliner Meilenblatt von 1790 ist dieser Bau deutlich eingetragen, doch fehlt er auf einer nahezu zeitgleichen Zeichnung des Schlossareals [L2002]; vermutlich war das Dach inzwischen eingestürzt, sodass das übrige Mauerwerk hinter der Ringmauer verborgen blieb. Im 17. Jahrhundert beherbergten die Gewölbe dieses Nebentrakts wahrscheinlich eine Küche (fol. 384 v [S1626]). Ende des 18. Jahrhunderts wurde das Gewölbe im kleinen Haus vom Vorwerkspächter zur Lagerung von Holz und Reißig genutzt und als „Holzgewölbe“ bezeichnet. (fol. 4r [Q1797_1808]) Eine Nutzung als Schuppen setzte sich auch im 19. Jahrhundert fort. Besonders bemerkenswert an diesem Gebäude sind die mehrfach erwähnten „Schießlöcher“ sowie der darunterliegende Keller. (fol. 4r [Q1797_1808])
Bergfried
Noch 1684 erinnerten sich Stollberger Bürger daran, dass vom sogenannten „großen Turm“ aus durch eine „Losung“ Alarm geschlagen wurde; bei Gefahr brachten sie dann Vieh und Hausrat hinter die schützenden Mauern des Schlosses (S. 114 [L1976_1978_1]). Der Bergfried war zu jener Zeit bereits baufällig und stellenweise einsturzgefährdet, blieb aber bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts funktionsfähig. Um die Statik zu verbessern, erwog man sogar, den Turm um 7 bis 8 Ellen – also etwa vier Meter – zu kürzen, setzte diesen Plan jedoch nicht um (S. 114 [L1976_1978_1]).
Ab 1744 ließ der Amtmann Liebe für eigene Bauten Steine vom Turm abtragen. 1750 ließ sich auch die Stadt Stollberg Wagenladungen mit Schlosssteinen – vermutlich ebenfalls vom Turm – anliefern (S. 114 [L1976_1978_1]). Spätestens mit Liebes Tod 1761 waren sowohl der alte Bergfried als auch die Hofmauer im Schlosshof verschwunden. Liebe hatte beides abtragen lassen, um den Hof als Garten nutzbar zu machen, und ließ zudem den Schlossgraben vor dem Tor um 14 Ellen aufschütten, sodass dort zwei weitere Gärten entstanden (fol. 6v [Q1796]).
kleiner Turm
Der kleine Turm stand um 1790 noch vollständig – samt der anschließenden Burgmauer – und ist sowohl auf dem Berliner Meilenblatt als auch auf einer zeitgleichen Darstellung des Schlosses erkennbar [L2002]. Seine Dachform hatte sich seit Dilichs Zeichnung von 1626 – 1629 verändert, Lage und Mauerwerk blieben jedoch offenbar unverändert [P1626_1629].
Unter dem kleinen Turm endeten nahezu die Keller des ehemaligen alten Hauses. Im Jahr 1810 war der Turm noch vorhanden und wurde als „alter, baufälliger Turm“ beschrieben. Im Zuge des geplanten Neubaus des Amtshauses auf dem Schlossgelände wurde er zusammen mit der hohen Wallmauer abgerissen, und die Steine für den Neubau genutzt (fol. 33r [Q1809_1819])
In den detailreichen Rissen von 1815 nach Bau des Amtshauses fehlt er daher, während sich sein ehemaliger Standort neben dem neu errichteten Amtshaus noch eindeutig lokalisieren lässt [P1815a]. Über die Nutzung im 18. Jahrhundert geben die Quellen nur sparsam Auskunft; wahrscheinlich diente der Bau als Frohnveste, was ein Hinweis von 1713 nahelegt, der den Neubau einer Stube sowie Arbeiten am Röhrwasser „in der Frohnveste“ erwähnt (fol. — [Q1699]).
4. Schloss Stollberg und Kammergut Hoheneck zwischen 1815 und 1862
zwischen der Errichtung des neuen Amthauses ab 1809 und Umbau zur Weiberstrafanstalt im Jahr 1862
Geschichtliche Entwicklung
Zwischen dem Neubau des Amtshauses ab 1809 auf dem Schlossgelände und der Zerschlagung des Kammerguts 1845
Am 4. September 1809 brach in Stollberg ein Feuer aus, das sämtliche Gebäude am Markt, einschließlich des Amtshauses (ehemals Rößlerisches Haus), zerstörte. (fol. 27r [Q1809_1819]) Beim Ausbruch des Feuers wurden die Akten, Kaufhandelsbücher und weitere Schriftstücke aus der Amtsstube in das Archivgewölbe gebracht, in dem sich bereits die älteren Akten und Schriften befanden. Das Archivgewölbe konnte dem Brand jedoch nicht standhalten und stürzte ein. (fol. 2r [Q1809_1819]) Bei einer anschließenden Erkundung des Archivgewölbes konnten einige Unterlagen gerettet werden – darunter Kassen- und Laßengelder, Buchungssachen und Rechnungen, laufende Amtsakten, Handelsbücher sowie Unterlagen zu den Intradengeldern. Ein großer Teil der alten Justizakten, Kassengelderverzeichnisse, „Repositoria“ und Zollakten fiel dem Feuer jedoch zum Opfer. (fol. 3r [Q1809_1819])
Nach dem Brand wurden noch verwertbare Bauteile des zerstörten Amtshauses – darunter Türen, Fenster und Balken – auf das Schloss gebracht. Eine Wiedererrichtung des Amtshauses innerhalb der Stadt Stollberg wurde ausdrücklich ausgeschlossen, um einer erneuten Brandgefahr vorzubeugen. Stattdessen sollte das neue Amtshaus am Standort des ehemaligen „Schlosses zu Hoheneck“ errichtet werden. (fol. 6r [Q1809_1819]) Die Akten des Amtes wurden im Jahr 1811 ohne jegliche Ordnung in der Amtsfrohnveste gelagert. (fol. 44v und 56r [Q1809_1819]) Die „Justizamt-Expedition“ wurde nach dem Brand vorläufig in ein Haus am Roßmarkt untergebracht, das dem Senator Hertel gehörte. (fol. 9r [Q1809_1819]) Das Rentamt bezog vorübergehend eine Kammer im Haus des Fußknecht-Adjunkten Müller beim Kammergut Hoheneck. Das abgebrannte Amtshaus in der Stadt wurde schließlich versteigert.
Das Schlossareal bot sich für den Bau eines neuen Amtshauses besonders an, da die auf dem alten Schloss vorhandenen „vorzüglich, schönen und brauchbaren“ Keller wieder genutzt werden konnten. (fol. 11r [Q1809_1819]) Bei einer Besichtigung im Jahr 1810 wurde festgestellt, dass sich rechter Hand des Eingangs (unter dem ehemaligen alten Haus) noch mehrere brauchbare Keller befinden und dieser Platz sich daher in besonderer Weise für den Neubau eignete. (fol. 32v [Q1809_1819]) Zudem konnten die Steine der alten Schlossmauern für den Bau wiederverwendet werden. (fol. 11r [Q1809_1819])
An der Stelle, an der die Keller nahezu enden, befand sich ein alter, baufälliger Turm, der für den Neubau abgetragen werden musste. Auch die hohe Wallmauer, die teilweise bereits eingestürzt war, musste entfernt werden. Die Steine des Turms und der Wallmauer sollten beim Bau des neuen Amtshauses als Baumaterial verwendet werden. Aufgrund der örtlichen Windverhältnisse wurde empfohlen, das Gebäude nur eingeschossig zu errichten und mit einer Schieferdeckung auszustatten. (fol. 33r [Q1809_1819]) Tatsächlich wurde das Amtshaus jedoch als zweigeschossiger Massivbau mit Parterre, Obergeschoss und ausgebautem Dachboden errichtet. Die Keller waren zu dieser Zeit unüberdacht und somit der Witterung ausgesetzt. Deshalb sollte darüber ein Holzschuppen zur Unterbringung von Feuerlöschgeräten und weiteren Gerätschaften sowie ein Pferdestall für die Beamten errichtet werden. (fol. 34r [Q1809_1819]) Für die geplanten Baumaßnahmen wurden sechs Bauanschläge sowie zwei Risse angefertigt (Riss N: Amtshaus, Riss B: komplettes Schlossgelände). Die Risse (fol. 34v und 40v [Q1809_1819]) sind in der Archivalie [Q1809_1819] selbst nicht enthalten. Möglicherweise befinden sie sich in der Archivalie „Bau eines neuen Amtshauses in Stollberg 1809–1813“ (Sächsisches Staatsarchiv, 30017 Amt Stollberg, Nr. 33), die jedoch im Rahmen der Recherchen nicht eingesehen werden konnte, da sie sich aufgrund ihres schlechten Erhaltungszustands zur Restaurierung in der Zentralwerkstatt des Archivzentrums Hubertusburg befindet.
Im Jahr 1812 wurde der Bau des neuen Amtshauses auf dem vorgeschlagenen Gelände des ehemaligen alten Schlosses genehmigt. (fol. 62r [Q1809_1819]) Die Räumlichkeiten des Neubaus wurden vermutlich bereits ab 1815 weitgehend genutzt. (fol. 91r [Q1809_1819]) Die endgültige Fertigstellung des Gebäudes erfolgte offenbar Ende 1818 bzw. Anfang 1819. (fol. 93v [Q1809_1819]) Der Riss [P1815a] wurde wahrscheinlich unmittelbar nach Fertigstellung des Amtshauses angefertigt und dokumentiert den Zustand um das Jahr 1815.

Abbildung 15: Situations Plan des Schlosses zu Stollberg und der Kammerguths Gebäude Hoheneck um 1815[P1815a]
Wegen ungünstiger Umstände wie Missernten und Krieg geriet Kammergutspächter Wilhelm Adolph Gestewitz in Pachtgeld-Rückstände. Als daraufhin eine erneute „Versteigerung“ (Licitation) anstand, erhielt Carl Friedrich Diersch den Zuschlag für das Kammergut Hoheneck [V1815]. Auch Diersch konnte jedoch die vereinbarte hohe Pachtsumme bald nicht mehr aufbringen und übergab das Gut noch 1815 an Johann Gottlob Schmidt, der in den laufenden Vertrag einstieg (fol. 16v [Q1816]).
Die Akten berichten von langwierigen Auseinandersetzungen zwischen den ehemaligen Vorwerkspächtern Gestewitz und Diersch einerseits sowie der Rentkammer andererseits. Dabei ging es um das vertraglich festgelegte Inventar des Kammergutes, die Folgen der Kriegsschäden und ausstehende Pachtzahlungen. Das Wohnhaus im Vorwerk wird als in gutem Zustand beschrieben, während sich der gegenüberliegende Pferde- und Ochsenstall in einem äußerst schlechten, sehr baufälligen Zustand befand [Q1814]. Angaben zum Schloss selbst sind rar; wiederholt wird lediglich ein kleines Gärtchen an der Amtsfrohnveste erwähnt (fol. 16r, fol. 60v [Q1814]).
Auch Pächter Schmidt geriet bis 1820 mehrmals mit seinen Pachtgeldern in Verzug, sodass es ähnlich wie bei seinen Vorgängern zu Streitigkeiten mit dem Justiz-/Rentamt Stollberg und dem Geheimen Finanz-Collegium in Dresden kam (Probleme mit Inventar, Defekten und fehlenden Vorräten) [Q1817][Q1818a].
Interessant ist zudem die erneute Ansiedlung von Häuslern: So erhielt etwa ein Strumpwirkermeister die Erlaubnis, gegen einen jährlichen Erbzins und sechs Frohntage auf dem Kammergut Hoheneck ein Haus zu bauen, wobei seine spätere Besteuerung ausdrücklich vorbehalten blieb (fol. 120r [Q1817]). Ähnlich wie schon 1701, als das Kammergut an den Accisrat Nester verkauft worden war, blieb das Kammergut Hoheneck auch um 1820 auf Frohndienste neu angesiedelter Textilarbeiter – darunter Strumpfwirker – angewiesen, nachdem die übrige Bevölkerung die Frohdienste großteils in Frohngelder umgewandelt hatte.
Der Name Hoheneck war zu jener Zeit noch immer nicht vom Kammergut auf das Schloss übergegangen; in den Akten wird dieses nach wie vor „Schloss Stollberg“ genannt (fol. 282 [Q1817]). Zwischen 1817 und 1819 taucht zudem häufig neben Amtmann Kempe ein Rentbeamter Wankel in den Unterlagen auf (fol. 60v [Q1817]), der ab etwa 1819 die Position des Amtmannes übernahm [Q1818a].
Nachdem das alte Amtshaus in der Stadt abrannte und man ab 1809 mit dem Neubau des Amtshauses im Schloss begann, starteten auch umfangreiche Bautätigkeiten am Kammergut. Aus einer zwischen 1815 und 1824 entstandenen Bauakte [Q1815] lassen sich umfangreiche Baumaßnahmen im Kammergut und teils auch am Schloss ableiten. Beim Kammergut betrafen die Arbeiten unter anderem:[Q1815]
- Malzdarre (Erneuerung Ziegelböden)
- Brauhaus (Erneuerung Inventar bspw. Maischbottich
- Brandweinbrennerei (Erneuerung Brennerei-Öfen, Brennblasen, Mösch- und Kühlgefäße)
- Umfangreiche Erneuerung des Pferde und Ochsenstall ab Jahr 1814/1815 (teilweilse einsturzgefährdet (fol 5v [Q1815]), teilweise Neubau siehe Zeichnung (fol. 78v [Q1815]))
- Scheune (Dachreparaturen (fol. 11v [Q1815]), Dach wird 1817 bei Sturm erneut beschädigt (fol. 28v [Q1815])
- Kuhstall (Dachreparaturen (fol. 11v [Q1815]))
- Neubau des Wagen und Geschirrschuppen (fol 84v [Q1815]), Bauanschlag fol 165r)
- Reparaturen an der Pächterwohnung (Fenster, Türen, Öfen, Neuverputz, Umbau Gesindestube)
- Rohrleitungen (Erneuerung des hölzernen Röhrwasser, Röhrwasser wird als stark beschrieben)
- Sonstiges (Hof- und Pflasterarbeiten)
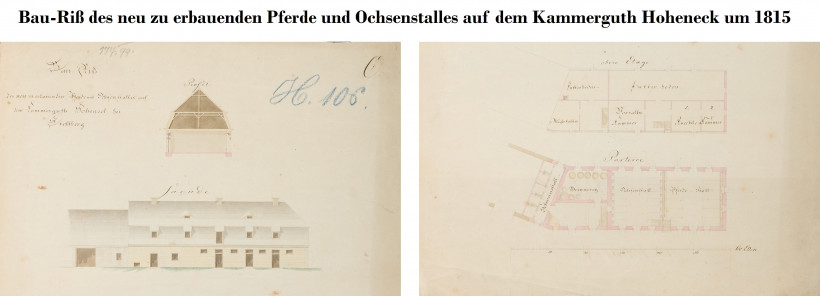
Abbildung 16: Bau-Riß des neu zu erbauenden Pferde und Ochsenstalles auf dem Kammerguth Hoheneck um 1815[P1815c]
Besonderes Augenmerk lag auf der Instandsetzung und Erneuerung des hölzernen Röhrwassers im Kammergut. Zusätzlich errichtete man 1815 im Schlosshof ein kleines Wasserhaus, das vom Röhrwasser des Kammerguts gespeist wurde, um das neue Amtshaus und die Amtsfrohnveste ausreichend mit Brauch- und Löschwasser zu versorgen (fol. 1v [Q1815]).
Die zum Kammergut Hoheneck gehörenden vier ärmlichen Tagelöhnerhäuser – darunter das sogenannte Köhnersche Haus – im vorderen Grund (Wiesenareal) sollten nach einem fiskalischen Beschluss von 1818 aufgekauft, abgebrochen und das Gelände dem Kammergut zugeschlagen werden. Diese Gebäude befanden sich zwischen der heutigen Stollberger Straße und der Zwönitzer Straße am Lerchenweg, nahe dem Zellerholz. Der Abriss wurde jedoch nur teilweise ausgeführt. In den zeitgenössischen Quellen ist weiterhin vom „Schloss Stollberg“ die Rede, nicht vom Schloss Hoheneck. [Q1818b]
Im Jahr 1819 ließ König Friedrich August von Sachsen das Kammergut Hoheneck durch den „Oberlandfeldmesser“ Wilhelm Ernst August von Schlieben vollständig kartieren und vermessen (fol. 1r [Q1819]). Er erfasste sämtliche Bestandteile des Gutes – Gebäude, Felder, Wiesen, Gärten, Teiche und Hutungen – sowie die Bauwerke des eigentlichen Schlosses Stollberg. In den Unterlagen heißt es unter anderem, der Schlossgraben solle künftig mit Laubbäumen aufgeforstet werden. Ebenfalls erneut vermerkt ist der Plan, die bereits genannten vier Tagelöhnerhäuschen im Vorderen Grund abzubrechen, um dem Kammergutspächter zusätzliche Wiesenfläche zu verschaffen. Die staatliche Revision diente allgemein dazu, den aktuellen Zustand des Kammerguts zu bewerten, einen Maßnahmenplan zur Erhöhung künftiger Staatseinnahmen zu entwickeln und die durch hohe Pachtlasten belasteten Kammergutspächter zu entlasten [Q1819]. Die vorhergehenden Kammergutspächter hatten allesamt große Probleme den Pachtzins rechtszeitig zu entrichten.
Im Zuge der Vermessung wurden sämtliche Grenzen kontrolliert und mit fortlaufend nummerierten Grenzsteinen neu markiert. Aus der Vermessung sind zahlreiche Risse und Skizzen erhalten (u. a. [P1817], [P1819a], [P1819b], [P1819c], fol. 168r – 169v [Q1819]). Der aussagekräftigste Überblick findet sich im Riss [P1819a], der sämtliche wesentlichen Objekte des Kammerguts samt Schlossareal detailliert darstellt:

Abbildung 17: Grundriss des Kammerguts Hoheneck um 1819[P1819a]
Im Bierstreit von 1820/21 prallten die Interessen der städtischen Bürgerbrauerei Stollberg und des königlichen Kammerguts Hoheneck aufeinander. Die Stadt berief sich auf ein angeblich „althergebrachtes“ Bierzwangs-Privileg und verlangte, das Kammergut vom Ausschank in mehreren umliegenden Amtsdörfern auszuschließen, um den Absatz ihrer – deutlich teureren – Bürgerbrauerei zu schützen. Hoheneck konterte mit Urkunden seit 1588, die ein gleichberechtigtes oder eigenes Ausschank- bzw. Ausschrotrecht belegten, und verwies auf die langjährig ungestörte Praxis sowie das Verbraucherinteresse an preisgünstigem Bier. Der vom König eingesetzte Schlichter Freiherr von Fischer schlug Kompromisse vor – etwa Selbstabholung statt Lieferung bzw. ein rotierendes Quartalssystem –, die die Stadt lediglich „ad referendum“ akzeptierte. Da eine verbindliche Einigung ausblieb, blieb der Status quo bestehen: Das Kammergut durfte weiterhin frei in alle Dörfer liefern, eine endgültige Entscheidung wurde vertagt.[Q1820a] Bemerkenswert ist auch, dass die Quellen von „Schloss zu Hoheneck“ sprechen (fol. 8r [Q1820a]).
Aufgrund der mangelhaften Bewirtschaftung des Kammerguts durch den Pächter Johann Gottlob Schmidt wurde im Jahr 1819 eine Verlängerung des Pachtverhältnisses abgelehnt. Bei der anschließenden Versteigerung des Kammerguts ging das höchste Gebot vom Stollberger Bürger und Handelsmann Friedrich Gotthilf Kaufmann ein. Dieses wurde jedoch aus Eigeninteresse abgelehnt, stattdessen entschied man sich für Friedrich Dürigen aus Gotha. Der Schlossgraben, der in der Vergangenheit als Viehweide genutzt worden war, sollte im Zuge der Neuverpachtung dem Forstamt vorbehalten und mit Laubholz bepflanzt werden (fol. 31v [Q1820b]). Zudem war vorgesehen, auf einer kleinen Fläche des Schlossgrabens einen Holzstall zu errichten (fol. 17r [Q1820b]). Um das Jahr 1820 gehörte dem Amtsfrohn ein Stück des zum Kammergut zählenden Eyergartens. Der Kammergutspächter wiederum nutzte einen Garten vor der Amtsfrohnfeste. Beide Gärten wurden mit der nächsten Pachtverschreibung ab dem Jahr 1820 getauscht [Q1820b].
Auch zwischen dem ehemaligen Kammergutspächter Schmidt und dem neuen Pächter Dürigen kam es zu Streitigkeiten aufgrund von Inventarschäden am Kammergut. Zudem geriet Dürigen regelmäßig in Pachtverzug, was unter anderem auf Probleme wie Preisverfall am Getreidemarkt und Dürren zurückzuführen war [Q1822]. Für das Jahr 1824 wird die Besoldung eines Nachtwächters für das Kammergut sowie die Amtsgebäude auf dem Schloss erwähnt (fol. 65v [Q1822]). Die verwaltungstechnische Hierarchie, wie sie aus den Akten hervorgeht, gestaltete sich wie folgt: König → Geheimes Finanz-Collegium → Kreis- bzw. Amtshauptmann → Amtmann → Pächter [Q1822].
Auf dem Gelände des Kammerguts entstanden weiterhin neue Häuser: Friedrich Traugott Schulz und Christian Lehmann Förster, erhielten die Erlaubnis, jeweils ein Haus auf dem Kammergutsgelände zu errichten – im Gegenzug verpflichteten sie sich zur Zahlung eines jährlichen Erbzinses sowie zu sechs Frohntagen. Zudem ist von umfangreichen Bauarbeiten am Damm an der Hofwiese an der Zwönitz (Chemnitzbach) bei Thalheim die Rede, die infolge von Hochwasserschäden erforderlich wurden [Q1827].
Aufgrund der soliden Bewirtschaftung des Kammerguts durch Friedrich Dürigen in den vorhergehenden Jahren wurde der Pachtvertrag im Jahr 1827 um weitere sechs Jahre bis 1833 verlängert [V1827a][V1827b][V1827c]. Insbesondere die Brauerei, Brennerei, Schäferei und Schweinezucht wurden während der Pachtzeit durch Dürigen deutlich verbessert. Die Ackerflächen waren ertragreich bearbeitet und von Steinen befreit worden [Q1825b]. Damit war er seit Langem einer der ersten Kammergutspächter, der während seiner Pachtzeit zufriedenstellende Ergebnisse erzielen konnte.
In den folgenden Jahren hatte er jedoch wiederholt Schwierigkeiten, den Pachtzins fristgerecht zu entrichten – bedingt unter anderem durch Hagelschäden und schwankende Getreidepreise [Q1828a]. Trotz dieser Probleme zeigte man sich im Jahr 1832 weiterhin zufrieden mit dem Kammergutspächter Dürigen, der durch verschiedene Maßnahmen – wie das Entfernen von Steinrainen und das Zusammenlegen von Feldern – den landwirtschaftlichen Ertrag erheblich gesteigert hatte. Daher wurde eine Verlängerung des Pachtverhältnisses empfohlen [Q1832a].
Für Friedrich Dürigen wurden zu Beginn der Pachtperioden 1827–1833 [V1828] und 1833–1845 [V1833b] jeweils ein Inventar angefertigt (siehe Inventargruppe 6b). Diese Inventare orientieren sich im Aufbau am Inventar von 1796 (Inventargruppe 6a), unterscheiden sich jedoch inhaltlich an vielen Stellen deutlich, da in den letzten Jahren umfangreiche Bautätigkeiten stattgefunden hatten. Die Inventargruppen 6a und 6b betreffen hauptsächlich Besitzungen auf dem Kammergutsgelände; im eigentlichen Schlossareal befanden sich lediglich zwei Bierkeller im Besitz des Kammergutspächters.
Aufgrund seiner guten und zuverlässigen Arbeit in den vergangenen Jahren wurde dem engagierten Kammergutspächter Friedrich Dürigen im Jahr 1833 die Pacht um weitere zwölf Jahre verlängert, da er das Kammergut mit eigenen Mitteln wesentlich verbessert hatte [Q1832b].
Im Jahr 1831 wurde ein nicht mehr benötigter, zum Kammergut gehörender Hundezwinger veräußert [Q1830]. Der Schlossgraben wird um das Jahr 1832 als mit Büschen und Dornsträuchern bewachsen beschrieben (fol. 17v [Q1832a]). Zudem wird ein Keller mit zwei Abteilen bei der Frohnveste erwähnt (fol. 30v [Q1832a]).
Zwischen 1831 und 1833 erfolgte in Hoheneck die Ablösung bzw. Umwandlung der Frondienste (Hand- und Spanndienste) der Hausgenossen in feste Geldrenten. Dem Wirt Leichsenring („Gasthof zur Sonne“) wurde in diesem Zusammenhang sein Eigentum in Erbpacht umgewandelt [Q1830]. Im Jahr 1833 waren die Handfrondienste der Hausgenossen schließlich vollständig abgelöst – ein Schritt, der den Übergang von feudalen Dienstpflichten hin zu einer modernen Geld- und Lohnwirtschaft markiert [Q1832b]. Lediglich die Geldrente, das sogenannte Frohndienstgeld, blieb bestehen. Die Häusler- und Hausgenossenliste mit festgesetzten Jahresbeträgen bildete fortan die Grundlage für die Kassierung durch das Rentamt [Q1834]. In den Archivalien wird von behördlicher Seite weiterhin ausdrücklich von „Schloss Stollberg“ gesprochen – nicht von „Schloss Hoheneck“. Lediglich das Kammergut trägt den Namen „Hoheneck“ (fol. 67r [Q1832b]).
Zwischen 1825 und 1834 erfolgten zahlreiche Bau- und Reparaturmaßnahmen an den Gebäuden des Kammerguts Hoheneck [Q1825a]. Beispiele hierfür sind:
- 1825: Neubau eines Heuschuppens auf der Thalheimer Hofwiese (fol. 3 [Q1825a]),
- 1824: Neubau eines Wagen- und Geschirrschuppens (fol. 47 [Q1825a]),
- Reparaturen an Mauern und Dächern mehrerer Scheunen,
- Instandsetzung von Inventargegenständen,
- Grundsanierung der Pächterwohnung,
- Bau einer steinernen Hofmauer am Kammergut (1833),
- Erneuerung der Brennerei- und Brautechnik,
- Maßnahmen zur Verbesserung der Wasser- und Abwasserversorgung.
Diese Bautätigkeiten betreffen ausschließlich das Kammergut Hoheneck; Schlossgebäude werden in den entsprechenden Akten dieser Zeit nicht erwähnt. Mehrere Bauanschläge dokumentieren detailliert die jeweiligen Arbeiten.
In der Bauakte von 1836 sowie in den Folgejahren werden weitere umfangreiche Bautätigkeiten am Kammergut aufgelistet, darunter die Erneuerung von Einfriedungen, Stall- und Wirtschaftsgebäuden, Wasserversorgung, Brauerei sowie Wohngebäuden [Q1836].
Neben diesen Arbeiten an den Kammergutsgebäuden sind auch Baumaßnahmen am Schloss, insbesondere an der Amtsfrohnveste, dokumentiert:
- 1842: Herstellung neuer Schutzkappen vor den Gefängnisfenstern auf dem Schloss Stollberg zur Verhinderung der Kommunikation der Gefangenen nach außen (fol. 116r [Q1836]),
- 1842: Erwähnung eines gewölbten, ehemaligen Justizamtsarchivs und einer Verhörstube in der Amtsfrohnveste (fol. 116r [Q1836]),
- 1842: Reparatur des Schindeldachs auf dem Bauschuppengebäude des Schlosses Stollberg (fol. 116r [Q1836]),
- 1843: Erwähnung Anbau eines steinernen Schuppens mit Schieferdach an der hinteren Giebelfront der Amtsfrohnveste; Nutzung als Toiletten- und Lagergebäude (Abtritt) (fol. 135r [Q1836]),
- Diskussion über die mögliche Umnutzung oder den Abriss eines Schuppens im Schlosshof, der erst 1842 ein neues Schindeldach erhalten hatte und als Holzlager für die Amtsfrohnfeste diente. Der Abriss wurde jedoch abgelehnt (fol. 144v [Q1836]),
- 1841: Erneuerung des Eingangs zum Bierkeller in der Nähe des Schlosseingangs mit einem neuen Türgerüst aus Sandstein und einer neuen Holztür (fol. 97v [Q1836]).
Der seit 20 Jahren tätige Justizamtmann Wankel wurde ab dem Jahr 1840 in den Akten durch den Rentbeamten Karl August Müller abgelöst, auch wenn dieser nicht die Amtsbezeichnung „Justizamtmann“ trug (fol. 85 [Q1838]). Eine kurzzeitige Überlegung um das Jahr 1839, das Kammergut im Zuge des neuen Grundsteuersystems durch die Grundsteuer-Kommission zu veräußern, wurde wieder verworfen (fol. 158 [Q1838]).
Im Jahr 1842 kam es infolge einer fehlerhaften oder manipulierten Wasserleitung im Wasserhaus auf dem Amthof – in Richtung des Amtshauses – zu einem spürbaren Wassermangel, sowohl auf dem Kammergut als auch in der Amtsfrohnveste, was insbesondere die Häftlinge und das Amtspersonal betraf. Die defekte Röhre wurde repariert, und es wurden verschiedene Verbesserungen bei dem Brunnen vorgenommen (fol. 136v [Q1838]).
Auf dem Gelände des Kammerguts wurden erneut mehrere Bauplätze an Strumpfwirker vergeben. Für den damit verbundenen Verlust an Hutungsfläche erhielt der Pächter Dürigen eine Entschädigung [Q1838].
Seit der Ministerialverfügung vom 14. August 1840 ist das königliche Kammergut Hoheneck – vertreten durch das Rentamt Stollberg – in die Parochial- und Schullasten der Gemeinde Hoheneck (bestehend seit 1838) einbezogen, die gemäß dem Gesetz von 1838 geregelt wurden [Q1840a]. Die Quote betrug zwei Drittel des von Gemeinde und Kammergut gemeinsam aufzubringenden Anteils, was rechnerisch einem Drittel der gesamten Lasten des Parochial- bzw. Schulbezirks entsprach.
Im Jahr 1841 bestand die Commune Hoheneck aus 30 Häuslern und 6 kleinen Gärtnern (fol. 8r [Q1840a]). Zu den vom Kammergut mitfinanzierten Maßnahmen zählten unter anderem der Neubau des Schulgebäudes auf dem sogenannten Eiergarten des Kammerguts (fol. 33r [Q1840a], Zahlungen 1842/43) sowie die Renovierung der Stollberger Hauptkirche einschließlich des Neubaus der Orgel (Zahlungen 1841–1847). Die Restverpflichtungen wurden bis Anfang 1848 beglichen.
Mit der Zerschlagung und Veräußerung des Kammerguts ab Mitte 1845 endeten die Parochiallasten (fol. 48v [Q1840a]). In den Quellen ist weiterhin ausdrücklich vom „Schloss Stollberg“ die Rede [Q1840a]. Eine weitere Archivalie [Q1840b] bestätigt die Angaben aus [Q1840a] und beschreibt die Gemeinde Hoheneck als „klein und sehr arm“.
In den Jahren um 1838 geriet der Kammergutspächter Friedrich Dürigen wiederholt in Zahlungsverzug und bat um Zahlungsaufschub, obwohl er weiterhin als rechtschaffener Mann gelobt wurde [Q1838]. Im Jahr 1840 war Dürigen mit seinen Pachtzahlungen um 1.222 Taler im Rückstand. Ursache dafür waren persönliche Schwierigkeiten sowie vor allem wirtschaftliche Rahmenbedingungen: der Beginn der Industriekonkurrenz führte zu Absatzproblemen des lokalen Biers, da zunehmend „Dresdner Vereinsbiere“ bevorzugt wurden; hinzu kamen Tiefpreise für Wolle. Infolgedessen sollte eine Zwangsvollstreckung („executivische Einbringung“ durch Pfändung) gegen ihn eingeleitet werden. Dürigen legte jedoch seine Beweggründe dar und bat um Ratenzahlung sowie um eine Herabsetzung der Jahrespacht. Das Finanzministerium gab seinen Bitten statt, übernahm die bis dahin entstandenen Kosten vollständig und stellte das Vollstreckungsverfahren ein [Q1840c].
Zwischen Zerschlagung des Kammerguts im Jahr 1845 und Einrichtung der (Weiber-) Strafanstalt im Jahr 1862
Die wachsenden Zahlungsrückstände des Pächters Friedrich Dürigen sowie die allgemeine Unwirtschaftlichkeit des Kammerguts infolge der zeitlichen Rahmenbedingungen – insbesondere der Industrialisierung und der Veränderung der Märkte – führten im Jahr 1843 zur Entscheidung des Finanzministeriums, das Kammergut nicht weiter zu verpachten, sondern die Grundstücke parzellenweise zu veräußern („dismembriren“) [Q1843].
Die Entscheidung zur Veräußerung beruhte nicht auf einem Versagen Dürigens, der in den letzten Jahren immer wieder als ein sehr fähiger Mann beschrieben wurde, sondern auf dem grundsätzlichen Ziel des Königreichs Sachsen, die Kammergüter angesichts der stetig sinkenden Pachtrendite zu verkaufen – ähnlich wie bereits 1698 zu Nesters Zeiten (fol. 31r [Q1843]).
Für den geplanten Verkauf mussten alle Flurstücke neu vermessen werden. Zu diesem Zweck wurde 1843 das Verzeichnis der Grundstücke des Kammerguts Hoheneck nach der Revision im Jahre 1843 zusammengestellt (fol. 10r [Q1843]). Eine zunächst angedachte, jedoch nicht umgesetzte Überlegung sah vor, die nördlich der Thalheimer Straße gelegenen Grundstücke dem sächsischen Staat als sogenanntes „Stammgut“ zu erhalten. Der deutlich größere Teil des Geländes – zwischen der Thalheimer Straße und der Chaussee nach Zwönitz sowie südlich der Stollberger-Zwönitzer Chaussee – sollte hingegen verkauft werden (fol. 5r [Q1843]).
Im Zuge dieser Umstrukturierung lösten im Jahr 1845 die Gärtner und Häusler ihre verbliebenen Hand- und Spanndienste endgültig gegen eine jährliche Geldrente ab. Sie waren damit dauerhaft von sämtlichen Frondiensten befreit (fol. 74r [Q1843]). Neben dem Rentbeamten Karl August Müller erscheint in den Unterlagen nun auch der Justizamtmann Heinrich Eduard Benisch (fol. 72r [Q1843]).
Die Handwerker in Hoheneck waren verpflichtet, ein Schutz- und Handwerksgeld an das Rentamt Stollberg zu zahlen. Diese Einnahme war als reservierte Einnahme des Kammerguts ausgewiesen und wurde nicht an den Pächter Dürigen weiterverpachtet, da das Dorf Hoheneck zum Kammergut Hoheneck gehörte. Im Jahr 1844 verweigerten mehrere Handwerker – darunter auch der Gasthofbesitzer Lehm – die Zahlung, da sie sich auf ein überholtes Abgabenrecht beriefen. In der Folge kam es zu einem Rechtsstreit vor dem Justizamt Stollberg. Die Klage wurde im Jahr 1846 endgültig abgewiesen, da der Fiskus nicht nachweisen konnte, dass die entsprechenden Zahlungen in der Vergangenheit ununterbrochen geleistet worden waren [Q1845b].
Die Geschichte des Schlosses sowie des Vorwerks bzw. Kammerguts wird im Jahr 1844 in der Archivalie [Q1844] auf fol. 17 kurz, aber detailliert zusammengefasst und bietet einen guten Überblick über die bisherige Entwicklung. Das Amt Stollberg wurde am 10. Juni 1564 von Kurfürst August von den Schönbergern erworben, welche es seit 1499 (laut Akte - wahrscheinlich jedoch bereits seit 1473) besessen hatten, und in das Amt Stollberg umgewandelt. Das Amt umfasste die Stadt Stollberg sowie 19 Dörfer, wobei mehrere Dörfer zuvor dem Amt Grünhain zugeordnet gewesen waren. Das Justizamt war mit dem Amt Grünhain kombiniert, dessen „Locale“ sich jedoch in der Stadt Stollberg befand. Nachdem das alte Amtsgebäude in der Stadt im Jahr 1809 abgebrannt war, wurde aus der Ruine des alten Schlosses das neue Amtshaus errichtet. Die Frohnveste wurde in den ehemaligen Räumen des Rentamts im Schloss untergebracht. Dem Kammergut verblieb dabei das exklusive Nutzungsrecht an einem geräumigen alten Schlosskeller, der sich unter einem Baugeräteschuppen mit Getreideboden und Schindeldach befand (fol. 17r [Q1844]). Frohndienste bestanden um 1844 nicht mehr. Das Vorwerk Hoheneck war am 3. April 1702 mitsamt Schäferei, Gebäuden, Schloss, Feldern und Wiesen an Nester veräußert worden und wurde im Jahr 1738 wieder zurückgekauft. Seit Nesters Zeit war das Kammergut fortlaufend verpachtet (fol. 32v [Q1844]).
Die Besitzungen des Kammerguts Hoheneck wurden in den Jahren 1844 bis 1846 – schwerpunktmäßig im Jahr 1845 – parzellenweise zerlegt und veräußert. Das sogenannte Stammgut, ein geschlossenes landwirtschaftliches Anwesen mit den wesentlichen Wirtschaftsgebäuden des ehemaligen Kammerguts, Feldern und Wiesen (vgl. Inventare 7), sowie das Brauhaus wurden aus dem Gesamtbesitz herausgelöst und an den ehemaligen Kammergutspächter Friedrich Dürigen verkauft. Dieser beabsichtigte, die Brauerei weiterzuverpachten, vermutlich an den Gastwirt Gotthard Lehm (fol. 20r [Q1846]).
Die Schlossgebäude, die zwei Schlosskeller und die Brennerei wurden dem auf dem Schlossgelände befindlichen Rentamt zugeordnet. Das ehemalige Wohnhaus des Kammergutspächters war jedoch nicht Bestandteil des neuen Stammguts, da es zukünftig ebenfalls dem Rentamt unterstellt werden sollte. Dürigen erhielt bis 1846 ein befristetes Wohnrecht, musste sich aber ein neues Wohnhaus errichten. Die Schlosskeller blieben im Staatsbesitz und sollten weiterhin verpachtet werden; die daraus resultierenden Einnahmen flossen dem Rentamt zu. Die Waldflächen wurden dem Staatsforst zugeschlagen. Die übrigen 132 Parzellen, die im Zuge der Dismembration (Zerlegung) entstanden waren, wurden öffentlich meistbietend versteigert. Ein gewölbtes Schuppengebäude (kleines Haus) sollte nach längeren Diskussionen aus Gründen des Schutzes des darunterliegenden Kellers nicht abgerissen werden [Q1844]. Gastwirt Gotthard Lehm beantragte zudem die Zuteilung eines Teils des großen Gartens für sein Gasthaus (fol. 6r [Q1844]). Bei der Versteigerung des Kammergutsbesitzes erwarben Friedrich Dürigen und Gotthard Lehm gemeinschaftlich insgesamt 19 Parzellen. Eine Abschrift der entsprechenden 19 Grundstücksfolien im Hohenecker Grund- und Hypothekenbuch befindet sich auf fol. 150r ff [Q1848].
Von der Veräußerung ausgenommen waren das Spritzenhaus samt Feuergeräte sowie das Wohnhaus und das gegenüberliegende Wirtschaftsgebäude des Kammerguts bis zu den jeweiligen Giebeln (fol. 2r [Q1844_1849a]). Nach der Übergabe des Wohnhauses von Friedrich Dürigen an das Rentamt sollte die Giebeltür zum Kuhstall zugemauert werden (fol. 186r [Q1844_1849a]).
Dürigen durfte beide Keller im Schloss auch nach der Zerschlagung des Kammerguts weiter pachten. Da es ihm nach der Versteigerung nicht mehr gestattet war, seine Kartoffeln wie zuvor in den Schlosshof (Renthof) zu fahren und in die im alten Bauschuppen (kleines Haus) befindlichen Löcher zu entladen, ließ er auf eigene Kosten einen neuen Weg zum linken Keller, vom Amtshoftor aus gesehen, außerhalb des Schlossgeländes anlegen (fol. 241v [Q1844_1849a]). Im "gewölbten Baugeräteschuppen" bestand somit ein direkter Zugang zu den darunterliegenden Kellern. Nach der Zerlegung des Kammerguts wurde festgestellt, dass es sich nun nicht mehr um ein rittergutsfähiges Gut handelte, wodurch sämtliche damit verbundenen Privilegien – insbesondere steuerliche – erloschen waren [Q1846].
Die Archivalien [Q1846][Q1848][Q1844_1849a][Q1844_1849b][Q1852][Q1857][Q1852_1870a][Q1852_1870b][Q1876] enthalten eine Vielzahl weitgehend identischer Verzeichnisse, die im Zusammenhang mit der Dismembration und Versteigerung des Kammerguts Hoheneck um das Jahr 1845 stehen und die Folgejahre von 1846 bis 1876 dokumentieren.
Das sogenannte Verzeichnis der vierteljährigen 4-%-Zinsen führt – getrennt nach
A. Stammgut,
B. Brauhaus und Pichschuppen,
C. einzeln veräußerten Parzellen (insgesamt 132 Positionen) –
die jeweils fälligen Zinsen auf noch ausstehende Kaufgeldreste auf. Diese Zinsbeträge wurden vierteljährlich an die Hauptstaatskasse abgeführt.
Das Verzeichnis der … Kaufgelder als die 2te Hälfte des Erstehungs-Quanti dokumentiert die tatsächlich eingegangenen zweiten Raten der Kaufgelder für die versteigerten Grundstücke. Nach vollständigem Zahlungseingang beantragte das Rentamt jeweils die Löschung der entsprechenden Hypotheken.
In den Quellen erscheint zusätzlich der Amtsactuar Friedrich August Hartmann, ein Gerichts- bzw. Verwaltungsbeamter im Justizamt. Er tritt in der Archivalie [Q1848] als Vertreter für den Justizamtmann Heinrich Eduard Benisch auf [Q1848]. Hartmann, der seit dem 1. Februar 1843 im Dienst war, bat um die mietsweise Überlassung der bisherigen Amtswohnung des Rentbeamten im Justizamtsgebäude (Amtshaus), da er aus gesundheitlichen Gründen nicht täglich den steilen Weg von der Stadt zum Schloss bewältigen konnte. Der Neubau eines Wohnhauses für den ehemaligen Kammergutspächter Friedrich Dürigen auf dem Stammgut kam nur schleppend voran. Anfang 1846 forderte das Rentamt nachdrücklich die baldige Freimachung des bisherigen Wohnhauses des Kammergutspächters (fol. 19r [Q1846]). Nachdem der Neubau des Wohnhauses abgeschlossen war, zog der Rentbeamte in das ehemalige Wohnhaus des Kammerguts um. Dadurch wurde auch die Wohnung im Amtshaus (Justizamtsgebäude) frei (fol. 62r [Q1846]). Das neue Wohnhaus Dürigens wurde spätestens im Jahr 1853 errichtet – mit hoher Wahrscheinlichkeit jedoch bereits kurz nach 1846 –, da es in jenem Jahr in den Unterlagen ausdrücklich von Dürigen selbst erwähnt wird [Q1852].
In offiziellen Schriftstücken ist weiterhin vom „Schloss Stollberg“ die Rede, z. B. im Vermerk „Königliches Justizamt zu Schloss Stollberg“ (fol. 206r [Q1846]).
Am Ende seiner Pacht im Jahr 1845 konnte der Pächter Friedrich Dürigen laut Angaben der sächsischen Verwaltung nicht alle Vertragspflichten seit Beginn des Kammergut-Pachtverhältnisses erfüllen – Dürigen selbst wies diesen Vorwurf entschieden zurück [Q1845a]. Im Jahr 1851 befand sich das Stammgut sowie die Brauerei weiterhin im Besitz Dürigens (fol. 261v [Q1848]). Er hatte jedoch erhebliche Schwierigkeiten bei der Zahlung der fälligen Zinsen, was insbesondere auf eine schwere Erkrankung zurückgeführt wurde (fol. 282v [Q1848]). In den Jahren nach 1845 stellte Dürigen wiederholt Anträge auf Zahlungsaufschub, die größtenteils auch bewilligt wurden [Q1844_1849b]. Auch elf Jahre später, im Jahr 1856, kämpfte er weiterhin mit Liquiditätsengpässen, scheint jedoch seine Zinszahlungen weiterhin fristgerecht geleistet zu haben [Q1852]. Dürigens fortgeschrittenes Alter machte sich allgemein zunehmend bemerkbar – er hatte immer wieder Schwierigkeiten, die fälligen Zinsen zuverlässig zu begleichen (fol. 117r [Q1852]).
Im Jahr 1853 wurden die noch verbliebenen grundherrlichen Abgaben der 46 Grundstückseigentümer von Hoheneck – darunter Erb-, Haus-, Brunnen- und Frohnzinsen – endgültig an das Rentamt Stollberg abgelöst [Q1853].
Ein Extract aus dem Jahr 1855 beschreibt die Nutzung der beim Verkauf des Kammerguts Hoheneck vorbehaltenen Wiesen- und Kellerflächen. Die Thalheimer Wiese wurde in mehrere Parzellen aufgeteilt und separat verpachtet. Die beiden Keller im Schloss waren auch in den Jahren 1854/1855 weiterhin an Friedrich Dürigen verpachtet (fol. 197r [Q1852_1870a]). Zudem wird das sogenannte Brunquell auf der Waschwiese erwähnt sowie die rechtlich geregelte Verpachtung dieses Wasservorkommens an die umliegenden Häusler. Auch das Röhrwasser, das beim Verkauf des Kammerguts im Jahr 1844 ausdrücklich nicht mitveräußert worden war, bleibt in staatlichem Besitz (fol. 164r [Q1857]).
Ab dem Jahr 1852 wird das Rentamt offiziell als „Königl. Rentamt Stollberg mit Grünhain“ bezeichnet (fol. 56v [Q1852]). In diesem Jahr erscheint erstmals Konstin Rudolf Erns in den Archivalien als Rentamtmann. Er trat offenbar die Nachfolge von Karl August Müller an und war bis 1854 im Amt (fol. 235r [Q1852]). Von 1854 bis 1856 übernahm Bernhard Heinze die Aufgaben des Rentamts (fol. 239r [Q1852]). Im November 1856 kehrte Karl August Müller vom Amt Pegau zurück und übernahm erneut die Leitung des Rentamts Stollberg von Heinze (fol. 278 [Q1852]; fol. 7r [Q1859]). Zu diesem Zeitpunkt wurde auch das Justizamt – bisher im Amtshaus auf dem Schloss untergebracht – in das 1812 errichtete Rathaus am Hauptmarkt 10 (heutiges Amtsgericht Stollberg) verlegt. Hintergrund war die Abschaffung der Patrimonialgerichtsbarkeit im Königreich Sachsen und die damit verbundene Einrichtung des Gerichtsamts Stollberg im Jahr 1856 im ehemaligen Rathaus (S. 108 [L2011]).
Das Rentamt selbst verblieb hingegen bis 1863 weiterhin auf dem Schloss-/ bzw. ehemaligen Kammergutsgelände (fol. 278r [Q1852]), zuletzt wahrscheinlich im ehemaligen Wohnhaus des früheren Kammergutsbesitzers Dürigen. Karl August Müller wird in den Akten noch bis 1859 für das Rentamt genannt, letztmals am 16. Juli 1859 (fol. 82r [Q1857]). Ab 1859 trat Carl Veser seine Nachfolge an und war bis 1863 als Rentbeamter tätig (1863 fol. 193r [Q1857]). Müller, der seit 1856 wieder als Rentamtmann in Stollberg tätig war, wurde im Jahr 1859 wegen Unterschlagung öffentlicher Gelder – unter anderem wegen eines Kassendefizits und weiterer Veruntreuungen – zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt. Seine Position übernahm Carl Veser [Q1859].
Am 11. April 1863 wird erstmals das „Rentamt Chemnitz mit Stollberg“ erwähnt (fol. 196r [Q1857]); am 1. Januar 1863 war hingegen noch vom „Rentamt Stollberg“ die Rede (fol. 193r [Q1857]). In diesen vier Monaten erfolgte offenbar die Verlegung des Rentamts von Schloss Stollberg nach Chemnitz. Die Abrechnung der rückständigen Zinsen übernahm fortan die Bauverwaltung Chemnitz (fol. 238 [Q1857]). Mit der Verlegung des Rentamts verlor das Schloss Stollberg Anfang 1863 schließlich endgültig seine letzte behördliche Funktion.
Bereits Anfang 1853 erklärte Friedrich Dürigen, er habe sein Stammgut verkauft, und bat daher um Erlass der noch ausstehenden Kaufgeldzinsen (fol. 87r [Q1852_1870a]). In den Kaufgeldabrechnungen taucht er jedoch weiterhin bis zum Jahr 1859 als Eigentümer des Stammguts auf. Erst am 4. Oktober 1859 ist in den Unterlagen vermerkt, dass das Stammgut von Friedrich Dürigen am 1. Oktober 1859 offiziell an den Gastwirt Christian Gotthold Lehm verkauft wurde (fol. 92v [Q1857]; fol. 1r [Q1852_1870b]).
Friedrich Dürigen war somit insgesamt 39 Jahre lang im Besitz des Gutes – zunächst als Pächter des Kammerguts, später als Eigentümer des daraus hervorgegangenen Stammguts. Er war der letzte Pächter des Kammerguts Hoheneck. Seine Leistungsbereitschaft und sein persönlicher Einsatz übertrafen die Leistungen seiner Vorgänger bei weitem. Dennoch konnte selbst sein außergewöhnliches Engagement den gesellschaftlichen Wandel und das damit besiegelte Ende des Kammerguts nicht aufhalten.
Mit Erlass vom 19. Mai 1877 beauftragte das Finanzministerium die Einziehung der seit der Zerschlagung des Kammerguts im Jahr 1844 offenstehenden Restkaufgelder – erforderlichenfalls gerichtlich über das Gericht Stollberg – sowie die anschließende Löschung der entsprechenden Hypotheken [Q1876]. Bis zum 31. Dezember 1877 waren sämtliche ausstehenden Restkaufgelder vollständig beglichen. Daraufhin ermächtigte das Ministerium am 4. Januar 1878 die zuständige Bauverwalterei zur endgültigen Löschung der Hypotheken im Grundbuch – ohne weitere Rückmeldungspflicht [Q1876].
Gebäudeübersicht
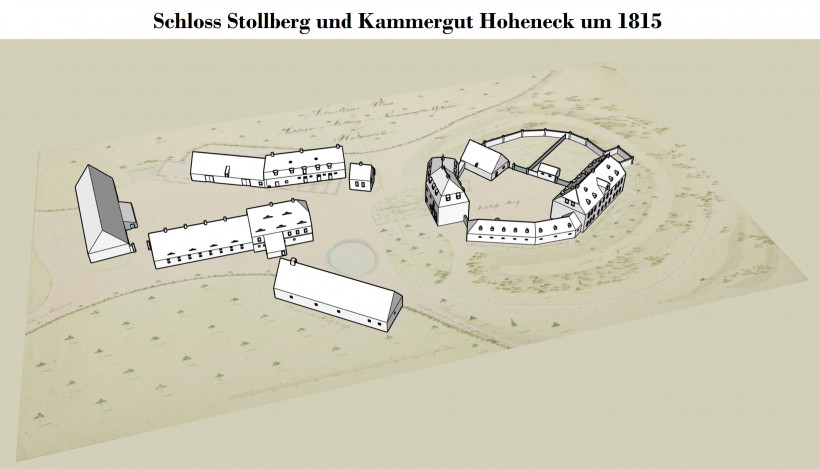
Abbildung 18: Schloss Stollberg und Kammergut Hoheneck um 1815 (eigene Darstellung)
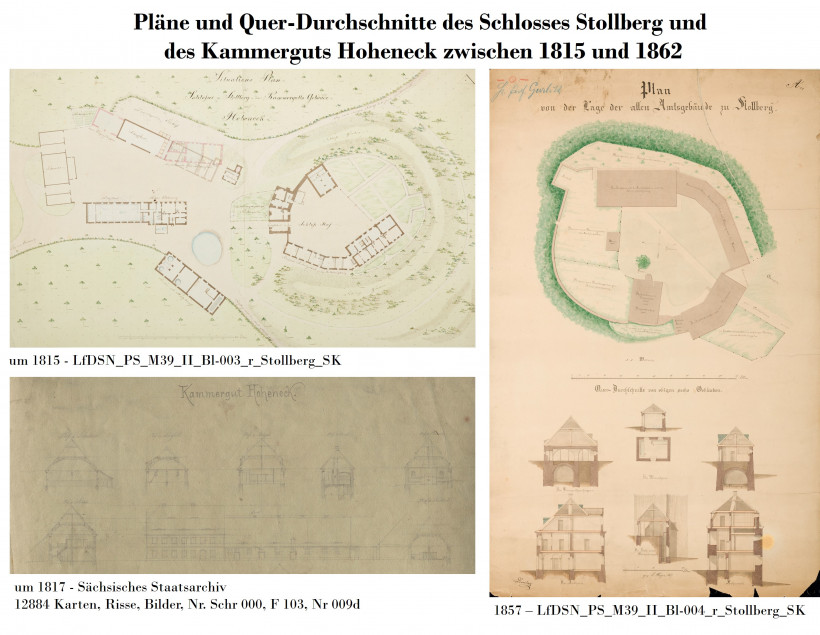
Abbildung 19: Pläne und Quer-Durschnitte des Schlosses Stollberg und des Kammerguts Hoheneck zwischen 1815 und 1862 (Pläne zwischen 1815 und 1857 [P1815a] (oben links) [P1817] (unten links)[P1857] (rechts) - auf Plan f[P1817] sind zusätzlich die Obergeschosse für die Kammergutsgebäude "Pächter Wohnung", "Brau- und Malzhaus" und das Backhaus angegeben)
Burg (Gebäude im Uhrzeigersinn - 2 erst 1857 nachweisbar)
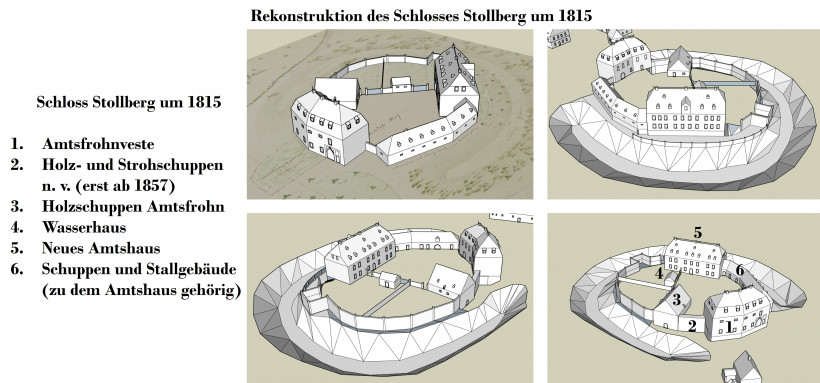
Abbildung 20: Rekonstruktion des Schlosses Stollberg um 1815 (eigene Darstellung)
1. Amtsfrohnveste[P1815a][P1815b], Die Amtsfrohnveste mit dem Thorhause[P1857] (neues Haus)
In der Amtsfrohnveste – dem ehemaligen „neuen Haus“ – wohnte spätestens ab dem Jahr 1808 der Amtsfrohn bzw. Amtswachtmeister. Dieser war in erster Linie für die Bewachung der Gefangenen zuständig, übernahm jedoch zusätzlich die Funktion des Schlossthorwärters. Da dem Amtsfrohn keine ausreichende Nahrungsversorgung zur Verfügung stand, war er auf eine gewisse Selbstversorgung angewiesen und benötigte deshalb einen Garten in der Nähe des Schlosses.
Gemäß einem Befehl vom 1. Juli 1819 wurde dem Amtsfrohn ein Teil des sogenannten Eiergartens zur Nutzung überlassen. Diese Zuteilung führte jedoch immer wieder zu Streitigkeiten mit dem Rentamt. Der Garten diente nicht nur dem Anbau von Lebensmitteln, sondern wurde auch für das Trocknen der Wäsche – sowohl für den Amtswachtmeister und seine Familie als auch für die Gefangenen – sowie zum Lüften der Gefangenendecken benötigt. Der kleine Garten direkt vor der Amtsfrohnveste wurde hingegen vom Rentbeamten genutzt [Q1842_1856].
Chronologische Reihenfolge der Amtsfrohnen bzw. Amtswachtmeister mit gleichzeitiger Ausübung der Schlossthorwärterstelle [Q1842_1856]:
- Unbekannt (möglicherweise bereits ab 1816) bis 1842: Karl Friedrich Hammer
- 1842 bis 1843: Wohllebe
- 1843 bis 1854: Friedrich Wilhelm Schilling (aus Pirna)
- 1854 bis mindestens 1856: Johann Gottlob Starke (nachdem Schilling nach Augustusburg versetzt wurde)
Die Position des Schlossthorwärters konnte ausschließlich vom Amtsfrohn übernommen werden, da dieser bereits in der Amtsfrohnveste auf dem Schlossgelände wohnte. Für eine eigenständige Schlossthorwärterstelle stand keine separate Wohnung zur Verfügung.
Im Jahr 1853 wird erstmals das neue Gerichtsgebäude in der Stadt Stollberg erwähnt. Im Jahr 1856 erfolgte schließlich die Übersiedlung des Justizamts vom Schloss Stollberg – aus dem dortigen Amtshaus – in dieses neue Gerichtsgebäude (ehemaliges Rathaus) in der Stadt [Q1842_1856].
Um das Jahr 1854 wurden in der Amtsfrohnveste bei guter Belegung über 20 Inhaftierte gleichzeitig untergebracht. Die Haftbedingungen hatten sich gegenüber den Vorjahren verbessert: Während zuvor lediglich eine Versorgung mit Brot vorgesehen war, erhielten die Gefangenen nun zusätzlich auch warmes Gemüse [Q1842_1856]. Die Amtsfrohnveste verfügte über insgesamt neun Gefängniszellen (S. 114 [L1976_1978_1]).
Im Jahr 1849, während der revolutionären Unruhen, wurde im Amtshaus auf dem Schloss Stollberg ein Wachlokal für ein aus Chemnitz herbeigerufenes Militärkommando eingerichtet. Dieses war mit der Bewachung der zahlreichen politischen Gefangenen betraut, die zu dieser Zeit in der Amtsfrohnveste untergebracht waren (S. 114 [L1976_1978_1]).
Die genauen baulichen Veränderungen beim Umbau des ehemaligen Amtshauses zur Amtsfrohnveste ab spätestens 1808 lassen sich nicht eindeutig rekonstruieren. Es ist jedoch belegt, dass im Verlauf des 19. Jahrhunderts bis zur Einrichtung der Strafanstalt im Jahr 1862 mehrere bauliche Maßnahmen durchgeführt wurden. Eine vollständige bauliche Umstrukturierung sind dabei jedoch nicht nachweisbar und dürften auch nicht erfolgt sein.
Zu den dokumentierten Maßnahmen gehören:
- 1842: Anbringung neuer Schutzkappen vor den Gefängnisfenstern im Schloss Stollberg, um die Kommunikation der Gefangenen nach außen zu unterbinden (fol. 116r [Q1836]),
- 1842: Erwähnung eines gewölbten, ehemaligen Justizamtsarchivs sowie einer Verhörstube innerhalb der Amtsfrohnveste (fol. 116r [Q1836]).
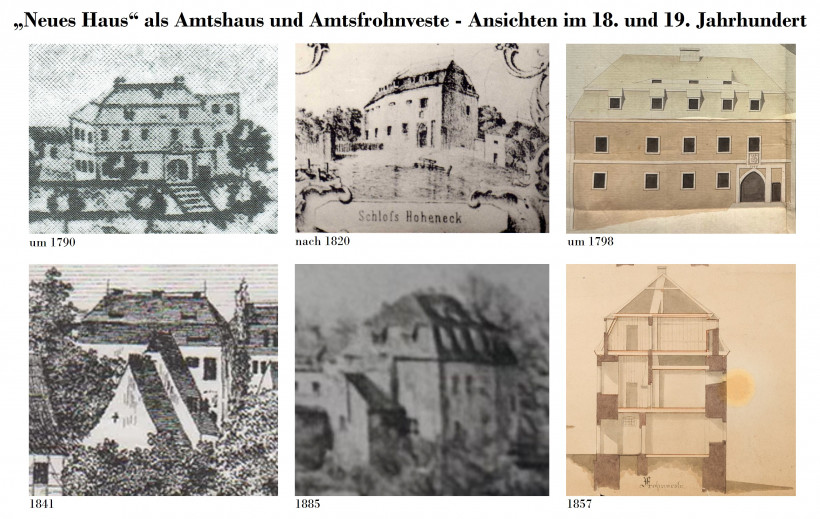
Abbildung 21: "Neues Haus" 1790 (S. 7 [L2002] und Stadtarchiv Stollberg Nr. unbekannt), nach 1820/ um 1830 (Stadtarchiv Stollberg Bildarchiv Nr. 1.13 5/10239), um 1798[P1798c], 1841 (S. 109 [L1841]), 1885 (Stadtarchiv Stollberg Bildarchiv Nr. 1.13 1093), 1857[P1857]
2. Holz- und Strohschuppen[P1857]
Vermutlich um das Jahr 1843 (fol. 135r [Q1836]) – wurde an der hinteren Giebelfront der Amtsfrohnveste ein steinern gebauter Schuppen mit Schieferdach errichtet. Dieser wird bei der Veräußerung des Kammerguts im Jahr 1845 bereits erwähnt, ist jedoch auf den älteren Rissen um 1815 noch nicht verzeichnet, was eine Errichtung in der Zwischenzeit wahrscheinlich macht.
Der Schuppen befand sich in einer Entfernung von 8½ Ellen zum Holzschuppen des Amtsfrohns und war direkt an die Amtsfrohnveste angebaut. Er verfügte zusätzlich über einen eingebauten Abtritt (fol. 149r [Q1844]).
3. Holz Schuppen für den Amtsfrohn [P1815a], Thatsbestandseffectenbehältniss und Baugerätheschuppen[P1857] (kleines Haus)
Der im Schlosshof befindliche Schuppen, der als Holzbehältnis für die Amtsfrohnveste genutzt wurde, sollte im Zuge der Veräußerung des Kammerguts explizit nicht abgerissen werden. Grund dafür war der darunterliegende Keller, der weiterhin für rentamtliche Zwecke genutzt werden sollte. Ein Abriss hätte die schützende Überdachung des Kellers entfernt. Zudem befand sich das Gebäude in einem guten baulichen Zustand (fol. 88v [Q1844]).
Im Erdgeschoss des Schuppens, das gewölbt und als feuerfest beschrieben wurde, schlug man zudem vor, künftig Akten des Justizamts aufzubewahren. Diese Archivumbaupläne wurden jedoch später aufgrund zu hoher Umbaukosten verworfen (fol. 99v [Q1844]).
Der Schuppen war 25 Ellen lang und 18 Ellen tief. Im Jahr 1845 wurde er zu zwei Dritteln als Holzschuppen für die Amtsfrohnveste und zu einem Drittel als Geräteschuppen durch das Rentamt genutzt. Auch 1845 wurde nochmals entschieden, den Schuppen nicht abzureißen, um den darunterliegenden Keller nicht ungeschützt der Witterung auszusetzen (fol. 149r [Q1844]). Allerdings sollten keine weiteren Reparaturen mehr an dem Gebäude vorgenommen werden.
Der Keller unter dem Holzschuppen war bereits über Jahre hinweg vor 1845 durch den Kammergutspächter genutzt worden. Das Gebäude selbst verfügte über einen Getreideboden und ein Schindeldach (fol. 17r [Q1844]).
Besonders bemerkenswert an dem genannten Schuppenbau ist die mehrfach dokumentierte Existenz von Öffnungen im Fußboden des Gebäudes, die direkt in den darunterliegenden Keller führten. Der ehemalige Kammergutspächter Friedrich Dürigen nutzte diese sogenannten „Kellerlöcher“, um von oben seine Kartoffeln direkt in den Keller zu schütten (fol. 241v [Q1844_1849a]).
Ein Zugang zu diesem Keller von außerhalb der Schlossmauern scheint im späten 18. Jahrhundert nicht vorhanden gewesen zu sein. Auf dem Riss von 1798 ist kein solcher Zugang eingezeichnet [P1798c], was durch eine zeitgenössische Quelle bestätigt wird:
Im Jahr 1797, als das sogenannte „Holzgewölbe“ noch vom Vorwerkspächter zur Lagerung von Holz und Reißig genutzt wurde und das Gebäude in ein Archivgebäude umfunktioniert werden sollte, sorgten die im Boden vorhandenen Kellerlöcher für Verwunderung. Der Landbaumeister Christian Adolph Francke deutete die Löcher zunächst als alte „Schießlöcher“ des ehemaligen Schlosses, da die Existenz des darunterliegenden Kellers offenbar in Vergessenheit geraten war (fol. 4r [Q1797_1808]).
Um 1798, also vor dem Neubau des Amtshauses, waren die Wallmauern links und rechts des Holzschuppens noch vollständig auf beiden Seiten vorhanden, wie der Riss von 1798 zeigt [P1798c]. Nach dem Neubau des Amtshauses wurden die Wallmauern bis zum sogenannten „kleinen Haus“ abgetragen. Lediglich das kurze Mauerstück zur Amtsfrohnveste blieb danach erhalten.[P1815a]
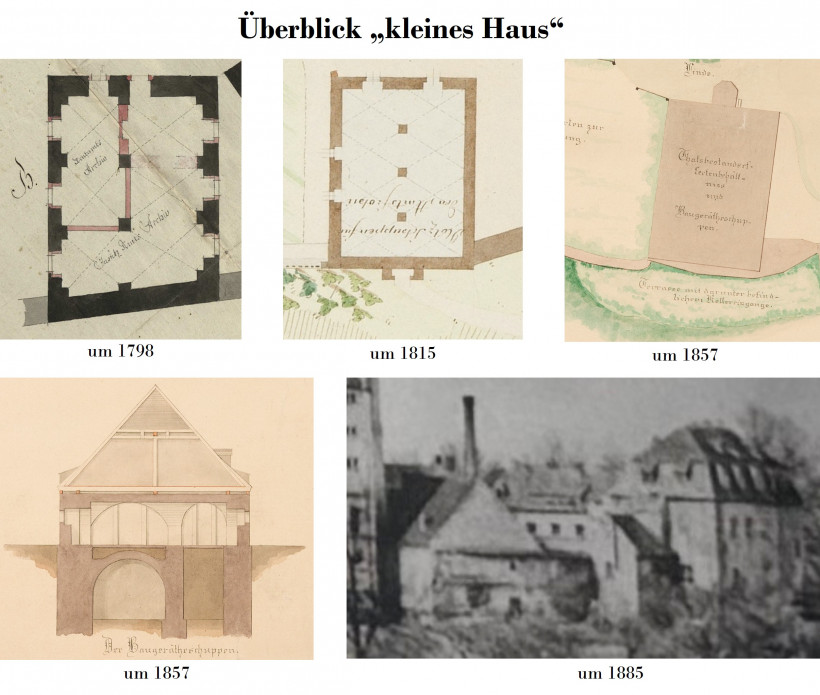
Abbildung 22: Überblick "kleines Haus" um 1798[P1798c], 1815[P1815a], 1857[P1857], 1885 (Stadtarchiv Stollberg Bildarchiv Nr. 1.13 1093)
4. Wasserhaus[P1857]
Im Jahr 1815 wurde im Schlosshof ein kleines Wasserhaus errichtet, das vom Röhrwasser des Kammerguts gespeist wurde. Es diente der Versorgung des neuen Amtshauses sowie der Amtsfrohnveste mit Brauch- und Löschwasser (fol. 1v [Q1815]).
Im Jahr 1842 kam es infolge einer fehlerhaften oder möglicherweise manipulierten Wasserleitung innerhalb des Wasserhauses – in Richtung des Amtshauses – zu einem spürbaren Wassermangel. Dieser betraf sowohl das Kammergut als auch die Amtsfrohnveste und wirkte sich insbesondere auf die Versorgung der Häftlinge und des Amtspersonals aus (fol. 136v [Q1838]).
Während der Veräußerung des Kammerguts im Jahr 1845 wurde das Wasserhaus als sanierungsbedürftig beschrieben – es befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem schlechten baulichem Zustand und soll daher saniert werden[Q1844].
5. Neu erbautes Amtshaus[P1815a], Das Amthaus mit der Justizbeamten- und der Actuariatswohnung[P1857]
In der Archivalie (fol. 33r [Q1844]) findet sich eine ausführliche Beschreibung des Justizamts (Amtshaus) auf dem Schloss Stollberg:
Das Justizamt besteht im Erdgeschoss aus einer größeren Amtsstube sowie zwei kleineren Stuben. Eine dieser kleineren Stuben wird von einem Beamten als Arbeitszimmer und Lagerraum genutzt, die andere dient als „Criminal-Expedition“ für Strafsachen sowie als Archivraum.
In den oberen Etagen befinden sich drei Zimmer, eine Kammer und eine Küche. Unter dem Dach ist eine weitere Stube mit Kammer untergebracht, die dem Justizbeamten zur Verfügung steht.
Das Rentamt nutzt die ehemals dem Amtsactuar überlassene Wohnung im selben Gebäude. Diese umfasst zwei Stuben, eine Kammer, eine Küche, einen weiteren Raum unter dem Dach, sowie im Erdgeschoss eine kleine Expedition mit einem Archivbehältnis.
Ein Botenzimmer fehlt im Schlossgebäude, was angesichts der Entfernung zur Stadt als nachteilig bewertet wird. Daher wird empfohlen, auch das ehemalige Wohnhaus des Kammergutspächters künftig zusätzlich als Amtsgebäude zu nutzen.
6. Schuppen und Stallgebäude zu dem Amthaus gehörig[P1815a], Gemeinschaftliches Schuppengebäude mit Stallung und den Kellern[P1857]
Das Schuppen- und Stallgebäude des Amtshauses wurde bei seiner Errichtung in erster Linie mit dem Zweck erbaut, den darunterliegenden Keller zu schützen (fol. 34r [Q1809_1819]). Vor dem Neubau des Amtshauses, also vor 1809, war der Keller unüberdacht, wurde jedoch bereits damals mehrfach für seine Qualität gelobt.
Der als „schöner Keller“ bezeichnete Gewölbekeller unter dem Pferdestall und Wagenschuppen wurde vor 1845 von der Brauerei genutzt und sollte auch nach der Veräußerung des Kammerguts weiterhin durch die Brauerei genutzt werden dürfen, da keine alternativen Lagermöglichkeiten vorhanden waren (fol. 89r [Q1844]).
Eine direkte Veräußerung des Kellers wurde jedoch abgelehnt. Beide Keller unter dem Schloss sollten nach der Veräußerung des Kammerguts im Besitz des Rentamts verbleiben.
Kammergut (Gebäude im Uhrzeigersinn)
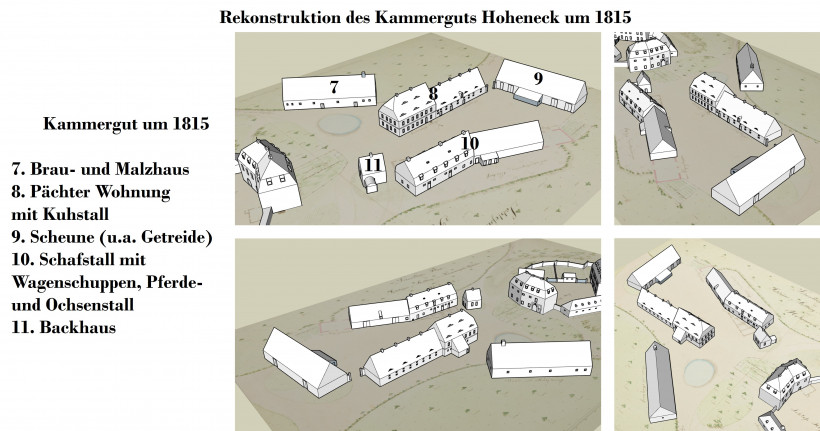
Abbildung 23: Rekonstruktion des Kammerguts Hoheneck um 1815 (eigene Darstellung)
- Brau- und Malzhaus[P1815a][P1815b]
- Pächter Wohnung mit Kuhstall[P1815a][P1815b]
- Scheune[P1815a], Getreide Scheune[P1815b]
- Schafstall mit neuen Wagenschuppen (links) und neu zu erbauenden Pferde und Ochsenstall (rechts)[P1815a], Schaf Stall mit neu zu erbauender Wagen und Geschirr Schuppen (links) und neu zu erbauender Pferde und OchsenStall (rechts)[P1815b]
- Backhaus[P1815a][P1815b]
Gärten im Schloss oder Vorwerk
A. dem Kammerguth gehöriger Küchengarten [P1815a] zur Rentbeamtenwohnung gehöriger Garten, vormals Amtsfrohngarten[P1857]
B. Blumen- und Gemüsegarten zur Actuariatswohnung[P1857]
C. Blumen- und Gemüsegarten des Justizbeamten[P1857]
D. Baumgarten zur Justizbeamtenwohnung gehörig[P1857]
E. Küchengarten (beim neuen Wagenschuppen im Kammergut)[P1815a]
Kellereingänge
a. Kellereingang am gemeinschaftlichen Schuppengebäude mit Stallung und den Kellern (K) [P1857]
b. Kellereingang unter der Terrasse beim Thatsbestandseffectenbehältniss und Baugerätheschuppen (L)[P1857]
Auf dem Plan f[P1817] der Vorwerksgebäude von 1817 sind zusätzlich die beiden Keller und Kellereingänge dargestellt. Das große Gebäude in der Mitte stellt die Amtsfrohnveste (1.1) dar .
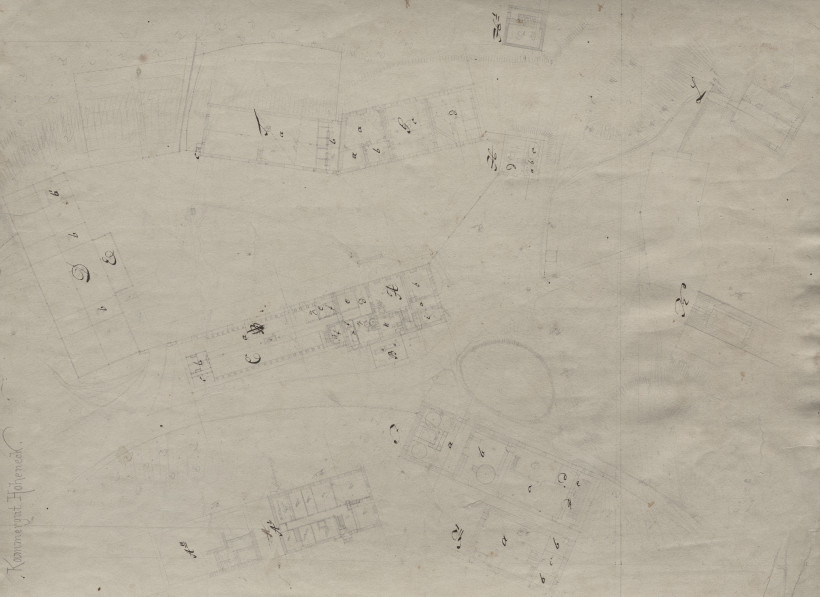
Abbildung 24: Plan f: Kammergut Hoheneck um 1817/19 mit allen Etagen und beiden Kellern im Schloß[P1817]
Gegenüberstellungen zwischen 1840 und 1841
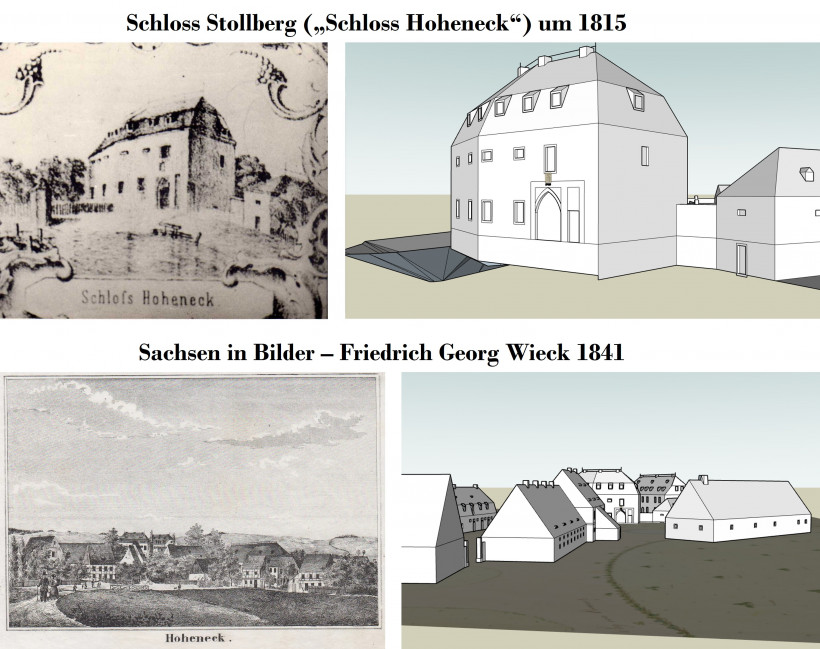
Abbildung 25: Schloss Stollberg ("Schloss Hoheneck") - oben links nach 1820 um 1830 (Stadtarchiv Stollberg Bildarchiv Nr. 1.13 5/10239), unten links um 1841 (S. 109 [L1841])
5. Umgestaltung zur (Weiber-) Strafanstalt nach 1862
Weiberstrafanstalt zwischen 1862 und 1886 (Bauphase I)
Seit den Umbauarbeiten zur Strafanstalt nach 1862 wird in den Unterlagen nicht mehr vom „Schloss Stollberg“, sondern vom „Schloss Hoheneck“ gesprochen (fol. 1r [Q1863_1870]).
Die Akte [Q1859_1871] gibt einen detaillierten Einblick in die Umwandlung des ehemaligen Schlosses Stollberg zur „Weiberstrafanstalt“ im Zeitraum von Januar 1859 bis November 1864. Die fachliche Gesamtleitung der Arbeiten lag beim Ministerial-Bauinspector Schmidt aus Dresden. Da die Anstaltsdirektion Zwickau als Haushalts- und Zahlstelle fungierte, ist die Akte [Q1859_1871] auch in den Verwaltungsakten des Zuchthauses Zwickau eingeordnet.
Bereits unter Rentamtmann August Müller war das ehemalige Schloss am 29. Januar 1859 als zukünftige Landesanstalt vorgesehen („zur Aufnahme einer Landesanstalt bestimmten Schlosse Hoheneck“, fol. 2r [Q1859_1871]). Die Einrichtungsarbeiten am Schloss Hoheneck waren im Jahr 1859 bereits im Gange (fol. 3r [Q1859_1871]). Gleichzeitig wurde festgestellt: „An den Schlossgebäuden zu Hoheneck macht sich eine bauliche Reparatur notwendig.“ (fol. 6r [Q1859_1871])
Im Jahr 1859 waren die zwei Keller unter dem Schloss sowie ein Schuppen an den Braumeister Kettner verpachtet (fol. 6r [Q1859_1871]). Gleichzeitig nutzten auch die Gutsbesitzer des Stammguts – zunächst Friedrich Dürigen, später sein Nachfolger Lehm – die Keller in Pacht (fol. 6v [Q1859_1871]). Am 13. Februar 1863 befanden sich die Keller weiterhin in der Pacht von Kettner und Lehm (fol. 20v [Q1859_1871]).
Das ehemalige Schloss Stollberg mit den dazugehörigen Gebäuden – einschließlich des Rentamtsgebäudes – sowie den Gartengrundstücken wurde am 16. Juni 1863 vom Rentamt offiziell an die Verwaltung des Ministeriums des Innern übergeben. (fol. 28r, fol. 30r [Q1859_1871]). Spätestens am 11. April 1863 ist in den Akten die Bezeichnung „Rentamt Chemnitz mit Stollberg“ zu finden (fol. 196r [Q1857]), während im Januar 1863 noch vom „Rentamt Stollberg“ die Rede war (fol. 193r [Q1857]). Mit der Übergabe des Rentamts an das Ministerium des Innern endete auch die bisherige Bezeichnung „Schloss Stollberg“. Im Oktober 1863 erhielt Rentamtmann Veser eine Entschädigung für die im früheren Rentamtsgebäude und in den Gartengrundstücken zurückgelassenen Gegenstände (fol. 32r [Q1859_1871]). Die Kellerverpachtung dürfte ebenfalls mit der Übergabe vom Rentamt an das Ministerium des Innern geendet haben.
Am 11. November 1862 werden die neu errichteten Gebäude allgemein als „Neubauen“ bezeichnet (fol. 16r [Q1859_1871]).
Die Hauptbauphase am sogenannten Facturen- und Zellengebäude begann im März 1863. Mit diesem Bau ist vermutlich der heutige Westflügel einschließlich des früheren Anbaus am Südflügel gemeint.
- 16. März 1863 – Erste Erwähnung des „Baus des Facturen- und Zellengebäudes auf dem Schlosse Hoheneck“ (fol. 21r [Q1859_1871])
- Juli 1863 – Aufbringen und Richten des Dachwerks auf dem Facturen- und Zellengebäude (fol. 24v [Q1859_1871])
- 4. Januar 1864 – Nachweis von Glaserarbeiten am Facturen- und Zellengebäude (fol. 38r [Q1859_1871])
- 28. März 1864 – Erwähnung einer geplanten Blitzableitung am "Facturen und Zellengebäude nebst Thurm auf dem Schloss Hoheneck" (fol. 53r [Q1859_1871])
- 11. Mai 1864 – Bauarbeiten an einer Secretanlage im Facturengebäude (fol. 56r [Q1859_1871])
- 5. Juli 1864 – Herstellung einer Kaltwasserleitung zu den Toiletten (Secreten) in den Strafzellen des Facturengebäudes in Hoheneck.
Ebenfalls im Jahr 1863, am 24. November, begannen die Arbeiten am „Kranken(burg)- und Speisesaalgebäude auf dem Schlosse Hoheneck“, auch „Krankenburggebäude“ genannt (fol. 35v [Q1859_1871]). Bei diesem Bauwerk handelt es sich vermutlich um den heutigen Nordflügel (S. 8 [L2002]). Am 26. Januar 1864 werden Zimmerarbeiten sowohl am neuen Facturen- als auch am Krankenburggebäude erwähnt (fol. 44r [Q1859_1871]). Am 30. März 1864 wird schließlich von Glaserarbeiten am Krankenburggebäude berichtet (fol. 49r [Q1859_1871]).
Im Januar 1864 erfolgten Umbauarbeiten am vormaligen Amtshaus auf dem Schloss. Dabei handelte es sich in erster Linie um Schmiedearbeiten (fol. 42v [Q1859_1871]). Am 6. April 1864 wird die Einfriedung des Areals des Schlosses Hoheneck erwähnt (fol. 54r [Q1859_1871]). Später, am 24. Juli 1864, wurde der Fußsteig „Amtssteig“ um das ehemalige Schloss von der Anstalt beseitigt.
Zwischen Juli 1864 und der Erstbelegung der neuen Anstalt am 7. November 1864 wurden zahlreiche Bauarbeiten durchgeführt[Q1859_1871]:
- Juli 1864: Anstreicharbeiten am Facturen- und Zellengebäude; Schieferdeckerarbeiten am "Wirtschaftsgebäude auf dem Schloss Hoheneck".
- 28. Juli 1864: Tischlerarbeiten am Krankenburg- und Speisesaalgebäude; Klempnerarbeiten am Wirtschaftsgebäude; Tischlerarbeiten am Expeditionsgebäude; Glaserarbeiten am Facturengebäude; Schlosserarbeiten am Facturengebäude.
- 17. August 1864: Schlosser- und Anstreicharbeiten am Kranken- und Speisesaalgebäude; Glaserarbeiten am Wirtschaftsgebäude; Schlosser- und Glaserarbeiten am Thor- und Expeditionsgebäude; Umbauarbeiten (Mauer- und Zimmermannsarbeiten) am Rentamtsgebäude (vermutlich das ehemalige Wohnhaus des Kammergutspächters); Umbauarbeiten (Mauer-, Dachdecker- und Zimmermannsarbeiten) am ehemaligen Bauschuppen.
- 9. Oktober 1864: Der Zimmermeister vollendet die Kanzel eines Altares; Einbau eines Eingangstors sowie eines Speiseaufzugs in der Hauptküche.
- 10. Oktober 1864: Der Klempnermeister beendet die Arbeiten an den Schlafzellen im 4. und 5. Stockwerk des Facturen- und Zellengebäudes; Tischler- und Anstreicharbeiten am Wirtschaftsgebäude; Klempner- und Malerarbeiten am Thor- und Expeditionsgebäude; Tischler-, Klempner- und Malerarbeiten am Directorialgebäude.
Auch nach der ersten Belegung im November 1864 wurden im Jahr 1865 noch verschiedene Abschlussarbeiten ausgeführt, darunter der Einbau von Ofenteilen und Drahtzäunen. Die erste Bauphase der neuen Strafanstalt war endgültig im Jahr 1870 abgeschlossen; die Neubauabrechnung lag zu diesem Zeitpunkt mit nur noch wenigen Schlussdifferenzen vor.
Auf zwei skizzenhaften Plänen aus der Zeit zwischen 1863 und 1870 (fol. 1v und eine weitere, unnummerierte Skizze auf einer der letzten Seiten [Q1863_1870]) wird die im Bau befindliche Strafanstalt – bereits als Schloss Hoheneck bezeichnet – in ihrer ersten Ausbaustufe dargestellt. Der Nordflügel ist zu diesem Zeitpunkt nur etwa zur Hälfte in seiner heutigen Form ausgebildet. Diese frühe Bauform wird auch durch die „Urkarte des sächsischen Katasters“ von 1883 [P1883a] bestätigt. Diese Karte gibt den baulichen Zustand des Sächsischen Weiberzuchthauses zwischen 1862 und 1886 am besten wieder, also noch vor den umfangreichen Erweiterungsarbeiten ab 1886 (Errichtung von Verwaltungsgebäude, Südflügel, Wirtschaftsgebäude und Verbindungshaus, S. 18 [L2002]). Dem Bau des neuen Nordflügels fiel das bisherige Amtshaus für das Rentamt auf dem Schloss zum Opfer. Das Rentamt befand sich danach – wie der Plan von 1863 nahelegt – vermutlich kurzfristig im ehemaligen Wohnhaus des Kammergutsbesitzers, das seit der Auflösung des Kammerguts im Jahr 1845 im Besitz des Fiskus war. Wie bereits erwähnt, wurde das Rentamt Stollberg um 1863 aufgelöst und in das Rentamt Chemnitz eingegliedert. Die ursprüngliche Länge des Nordflügels war durch das danebenliegende ehemalige „Gemeinschaftliche Schuppengebäude mit Stallung und den Kellern“ begrenzt. Dieses alte Schuppengebäude scheint in den Anfangsjahren der Strafanstalt weiter genutzt und bis spätestens 1883 ausgebaut bzw. umgebaut worden zu sein. Auf der zweiten Skizze der Strafanstalt in[Q1863_1870] ist das Schuppengebäude noch in seiner ursprünglichen Form vor 1862 dargestellt, wohingegen die Katasterkarte von 1883 [P1883a] bereits die erweiterte Form zeigt. Weitere größere Bauarbeiten lassen sich anhand der vorhandenen Skizzen und Pläne für den Zeitraum zwischen 1862 und 1883 nicht nachweisen.
Der 1863 errichtete Westflügel (fol. 1v [Q1863_1870]) wurde bereits in seiner heutigen Gestalt ausgeführt. An der Stelle des heutigen Südflügels besaß er einen Anbau mit Turm. Der Turm befindet sich noch heute an seiner ursprünglichen Position, während der eigentliche Südflügel erst nach 1886 erneuert wurde. Das gewölbte Schuppengebäude mit Keller/ Bauschuppen (ehemaliges Kleines Haus) und die Amtsfrohnveste (ehemaliges Neues Haus) wurden in der ersten Periode als Weiberzuchthaus bis 1886 weiterhin baulich genutzt. Vor dem „Schloss Hoheneck“ zeigt der Plan um 1863 (fol. 1v [Q1863_1870]) auf dem ehemaligen Kammergutsgelände – neben dem vorübergehenden Rentamt im ehemaligen Wohnhaus des Kammergutspächters – noch die Brauerei und den Ententeich. Der Schlossgraben wird 1864 noch ausdrücklich erwähnt (fol. 18r [Q1863_1870]) und muss daher in Teilen weiterhin vorhanden gewesen sein. In der ersten Ausbaustufe zwischen 1862 und 1886 kann somit – entgegen vielfach geäußerter Darstellungen in der Literatur – nicht davon die Rede sein, dass das alte Schloss vollständig abgetragen und an gleicher Stelle eine gänzlich neue Weiberstrafanstalt errichtet wurde. Vielmehr wurden ein Großteil der bestehenden Gebäude (Amtsfrohnveste / Neues Haus, gemeinschaftliches Schuppengebäude mit Stallung und Kellern, Bauschuppen / Kleines Haus) weitergenutzt und lediglich durch Neubauten ergänzt (Teile des Nordflügels, Westflügel, Teil des Südflügels, Turm). Lediglich das rund 50 Jahre alte Amtshaus wurde von den Hauptgebäuden auf dem Schlossgelände entfernt. Von einer großflächigen Beseitigung historischer Bausubstanz des ehemaligen Schlosses Stollberg kann daher erst ab der zweiten Bauphase um 1886 gesprochen werden.
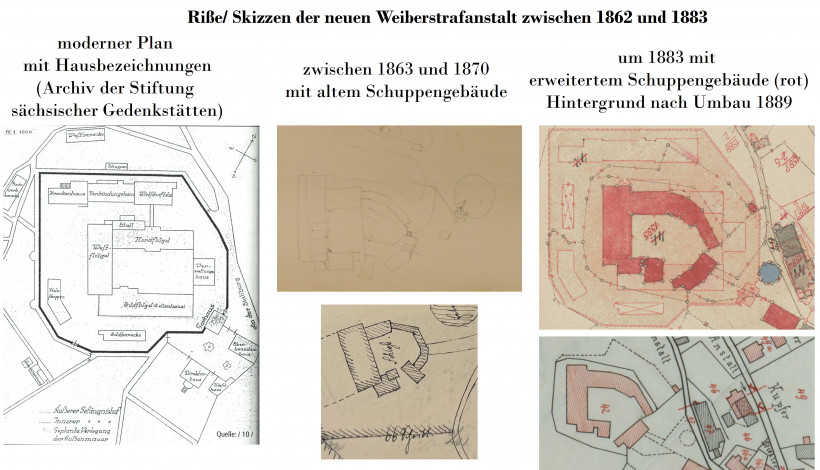
Abbildung 26: Riße/ Skizzen der neuen Weiberstrafanstalt zwischen 1862 und 1886 (moderner Plan mit Hausbezeichnung S.8 [L2002], Skizzen Mitte um 1863 [P1863a][P1863c], 1883[P1883a][P1876a])
Am 07. November 1864 ist die Einrichtung der Anstalt Hoheneck soweit fortgeschritten, dass mit der Übersiedlung der weiblichen Häftlinge von Hubertusburg begonnen werden kann (fol. 3r [Q1864_1874]). Im Dezember 1864 erfolgt die Erstbelegung: An zwei Tagen werden jeweils 20 Gefangene nach Hoheneck überführt (fol. 25v [Q1864_1874]). In den Akten wird sowohl vom „Schloss Hoheneck“ (fol. 4r [Q1864_1874]) als auch häufig von der (Straf-)„Anstalt Hoheneck“ (fol. 9r [Q1864_1874]) gesprochen. Im Februar 1865 befinden sich noch einzelne Gebäudeteile im Bau (fol. 32r [Q1864_1874]). Zu diesem Zeitpunkt müssen zudem noch 89 Sträflinge aus Hubertusburg nach Hoheneck überführt werden (fol. 32r [Q1864_1874]). Mit Abschluss dieser Überführungen wird die Frauenstrafanstalt in Hubertusburg endgültig aufgehoben [Q1864_1874].
Am 24. Dezember 1863 wird das Grundstück Nr. 42 (Flurstücke 52 und 55) von Johann Friedrich Schettler für die neue Frauenstrafanstalt Hoheneck erworben (fol. 36r [Q1859_1871]). Zum Anwesen gehören Haus, Garten, Feld und Wiese.
Um einen geschlossenen Sicherheitsring um die Anstalt zu schaffen, erwirbt der Staat zudem das Röhnersche Haus von Friedrich Traugott Röhner, Strumpfwirkermeister und Hausbesitzer. Röhner erhält im Tausch einen größeren Teil des neu erworbenen Schettler-Gartens. Sein altes Fachwerkhaus mit Strohdach wird abgerissen. Damit verfügt die königliche Strafanstalt Hoheneck über ein vollständig umschließendes Gelände ohne private Wohnhäuser (fol. 1v, [Q1863_1870]). Um 1864 erscheint in den Akten die Bezeichnung „Königliche Strafanstalt Hoheneck“ (fol. 29r [Q1863_1870]).
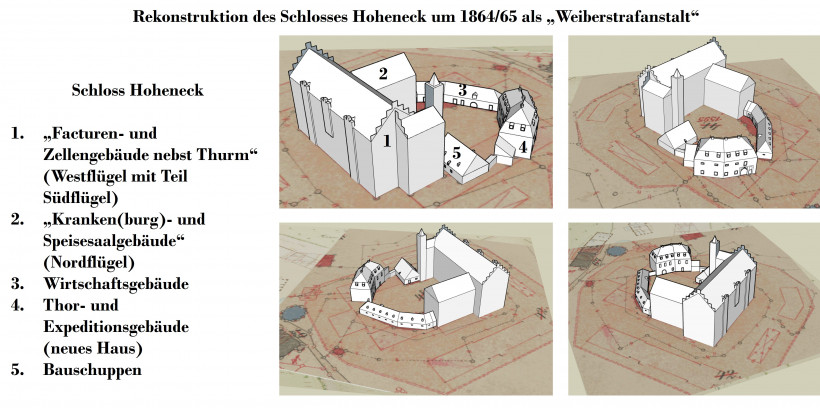
Abbildung 27: Rekonstruktion des Schlosses Hoheneck um 1864/65 als "Weiberstrafanstalt" (eigene Darstellung)
Um 1865 regelt der Röhrmeister die Aufteilung des hölzernen Röhrwassers wie folgt: 9/24 in die Haftanstalt, 3/24 in das Directorialwohngebäude, 4/24 in die Brauerei und 8/24 in das Landgut (Stammgut). In den Folgejahren erfolgen umfassende Erneuerungen an Röhren, Brunnen und Quellen – unter anderem wird um 1869 der Ersatz der Holzröhren durch eiserne Röhren sowie die Ausmauerung hölzerner Brunnenstücke durchgeführt (fol. 67r [Q1862_1888]). Erwähnt wird außerdem, dass bereits im heißen und trockenen Sommer 1842 auf der Waschwiese ein Brunnen gegraben wurde, da das Röhrwasser zeitweise versiegte (fol. 124r [Q1862_1888]).
Im Thorgebäude – wahrscheinlich das ehemalige „Neue Haus“ bzw. die Amtsfrohnveste – werden die dort wohnenden Beamten erwähnt (fol. 84v [Q1862_1888]). Weitere in den Quellen genannte Gebäude sind: das Anstaltsgebäude (Hauptgebäude), das Direktorialwohngebäude, ein Kesselhaus ?(fol. 99v [Q1862_1888]) sowie das Fakturen- und Krankenstationsgebäude (fol. 107r [Q1862_1888]).
1865 wurde an der heutigen Thalheimer Straße ein Friedhof für Beamte und Gefangene der Anstalt angelegt. Die Gräber der Gefangenen waren mit einfachen schwarzen Kreuzen versehen. Außerdem wurden Ruhebänke aufgestellt, und über der Eingangspforte befand sich der Spruch: „Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet.“ (fol. 14r [Q1865_1899])
1865/66 errichtete der Bäckermeister Karl Wilhelm Müller (Hoheneck) neben der neu gegründeten Strafanstalt Hoheneck ein massives Wohn- und Wirtschaftsgebäude, um günstigen Wohnraum für Anstaltsbeamte zu schaffen. Das Wohnhaus wurde hauptsächlich für Beamtenwohnungen genutzt. Müller geriet aufgrund zu hoher Baukosten in Liquiditätsprobleme und bot das Gebäude 1866 dem Staat zum Kauf an – der Verkauf wurde jedoch abgelehnt. Stattdessen gewährte man ihm ein Darlehen, das er 1868 vollständig zurückzahlte (Hypothek gelöscht). [Q1866_1870]
Das dem Cigarrenfabrikanten Dressler in Hoheneck gehörige Fabrikgebäude wurde 1875/76 für die Zwecke der Strafanstalt Hoheneck aufgekauft und für die Einrichtung geplanter Wohn- und Arbeitsräume umgestaltet. [Q1875_1878]
Der Feldweg an der ehemaligen Dresslerfabrik wurde im Zuge des Baus der Hofmauer verlegt. 1876 wurde zusätzlich eine Menselblattkopie angefertigt. Drei identische Exemplare dieses Menselblattes sind der Archivalie [Q1876_1935] zugeordnet und regeln, welche Anlieger welchen Abschnitt des Schlossweges bei Glatteis zu streuen haben: „Der Schlossweg ist von den Anliegern nach folgender Einteilung bei Glatteis zu streuen.“ [Q1876_1935]
1888 errichtet die Gemeinde Hoheneck neben der „Kaserne“ der Anstalt (ehemals Dresslerfabrik) ein neues Schulhaus und beantragt, das Dach- und Oberflächenwasser über ein Anstalts-Flurstück ableiten zu dürfen. Für dieses Vorhaben wird eine Planskizze angefertigt. Dem Antrag wird schließlich zugestimmt. [Q1883_1911]
In den Jahren 1875/76 unternimmt die Landesanstalt Hoheneck mehrere Versuche, Acker- und Baugrundstücke zu pachten oder zu erwerben, um die Eigenversorgung der Haftanstalt mit Nahrungsmitteln zu sichern. So werden beispielsweise die Parzellen 158–163 von den Besitzern des Gasthofes „Zur Sonne“ zwischen der Thalheimer und Zwönitzer Straße (am „Hasendorf“) für den Anbau von Feldfrüchten angepachtet (enthält ein beigelegtes Menselblatt um 1875). Vom Gasthof Zur Sonne wird berichtet, dass er am 18. Juli 1875 abgebrannt sei. Der Wiederaufbau wurde zwar begonnen, doch führten Brandschaden und Schulden schließlich zur Insolvenz der Besitzer. [Q1875_1887]
Im Jahr 1879 erwirbt die Anstalt eine im Besitz von Carl Herrmann Reinholz befindliche Feldparzelle, um zu verhindern, dass unmittelbar an der Gefängnismauer Wohnhäuser entstehen. Mit dem Ankauf werden zugleich die Anstaltsfelder für die Eigenversorgung (Feldfruchtbau) erweitert und ein störungsfreier Zugang zum Anstaltsfriedhof gesichert, der über dieses Grundstück führt. [Q1879_1882]
Um 1885 werden in den Quellen mehrere Gebäude der Anstalt genannt: das Expeditionsgebäude, das Directorialwohngebäude, ein Beamtenwohngebäude (ehemaliges Direktorialwohnhaus) sowie das Spritzenhaus. Ein neues Krankenhaus war vermutlich bereits um 1877 errichtet worden; zudem wird ein Flügelanbau erwähnt. (fol. 8r [Q1884_1896])
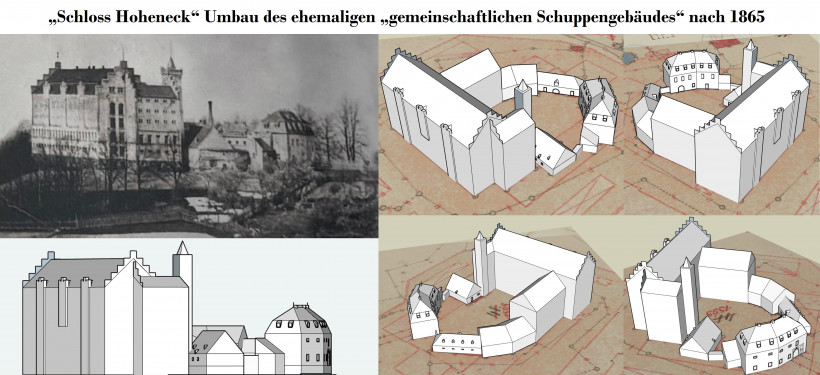
Abbildung 28: "Schloss Hoheneck" Umbau des ehemaligen "gemeinschaftlichen Schuppengebäudes" nach 1865 (oben links Ansicht um 1885 siehe Stadtarchiv Stollberg Bildarchiv Nr. 1.13 1093)
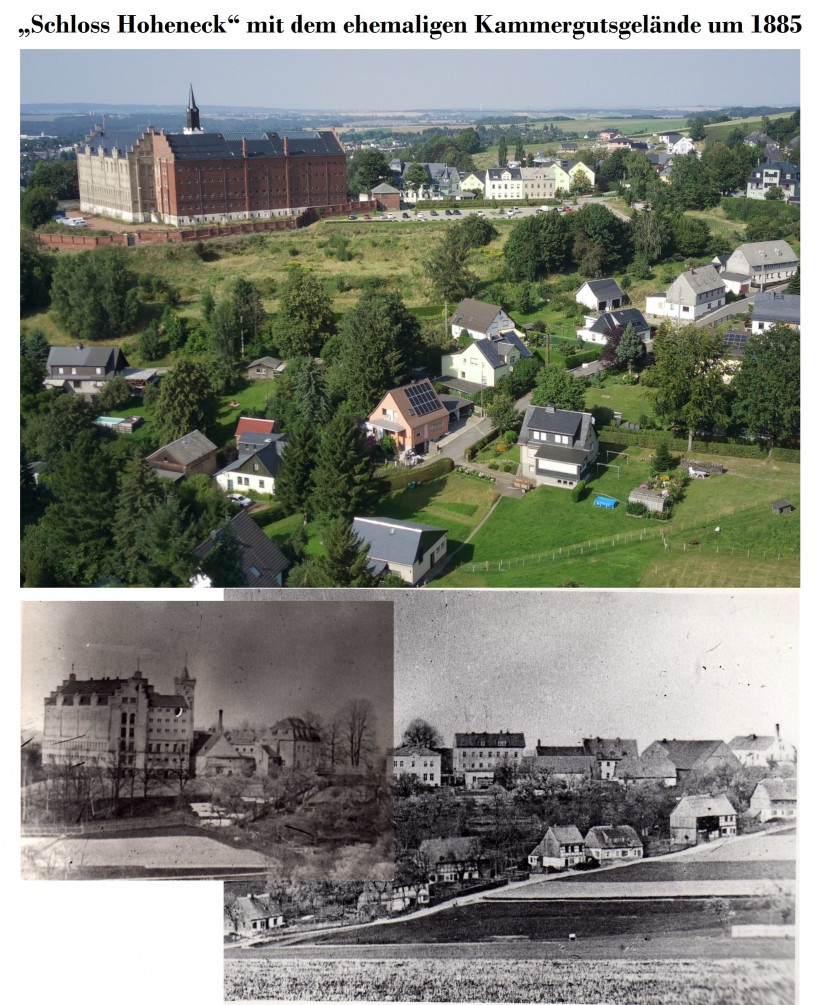
Abbildung 29: "Schloss Hoheneck" mit dem ehemaligen Kammergutsgelände um 1885 (eigene Drohnenaufnahme, historische Ansichten um 1885 siehe Stadtarchiv Stollberg Bildarchiv Nr. 1.13 1093 und Nr. 1.13 1317)
Umbau-/ Erweiterungsarbeiten ab 1886 für die Landesstrafanstalt für Männer (Bauphase II)
Im Jahr 1886 wurde das Weiberzuchthaus nach Waldheim verlegt (S. 18 [L2002]). Anschließend erfolgten zwischen 1886 und 1889 umfangreiche Erweiterungsbauten:
Das seit 1564 bestehende „Neue Haus“ (zuletzt als Thor- und Expeditionsgebäude genutzt) wurde nach über 300 Jahren gemeinsam mit dem „Kleinen Haus“ (zuletzt Bauschuppen) abgetragen. An ihrer Stelle entstand der heutige Südflügel. Der Schlussstein des ehemaligen Neuen Hauses mit der Jahreszahl 1564 wurde am ebenfalls neu errichteten Verwaltungsgebäude (Ostflügel) angebracht, ergänzt um die Jahreszahl 1887 (wahrscheinlich das Baujahr). Dieses Verwaltungsgebäude, auch Expeditionsgebäude genannt, übernahm vermutlich die Funktion des abgerissenen Schlossgebäudes (Neues Haus).
Das zuvor erweiterte „Gemeinschaftliche Schuppengebäude mit Stallung und Kellern“ (zuletzt wohl Wirtschaftsgebäude) wurde ebenfalls entfernt. An seiner Stelle erfolgte die Erweiterung des heutigen Nordflügels.
Mit diesen Umbauarbeiten zwischen 1886 und 1889 verschwanden schließlich sämtliche noch vorhandenen Gebäude des ehemaligen „Schlosses Stollberg“. Das Erscheinungsbild der Anlage hat sich seitdem im Wesentlichen bis ins Jahr 2025 erhalten.
Die in den beiden Bauphasen errichteten Gebäude lassen sich deutlich an ihrer Bauausführung unterscheiden:
- Erste Bauphase (1862–1864): Errichtung des Westflügels und des ersten Teils des Nordflügels als graubrauner Putzbau. Auch der noch heute existierende kleine Baukörper am Südflügel zwischen Westflügel und Turm gehört vermutlich noch in diese Bauphase.
- Zweite Bauphase (1886–1889): Errichtung des Südflügels, des Ostflügels sowie des Nordflügel-Anbaus als Ziegelbauwerke.
Nach Abschluss der umfangreichen Umbauten im Jahr 1889 wurde die Anlage als Landesstrafanstalt für Männer bezogen. Die offizielle Bezeichnung lautete im Jahr 1892: „Landesanstalt Hoheneck als Landesgefängnis für Männer“ (fol. 16r [Q1865_1899]).
Der bauliche Zustand innerhalb des Schlosses Hoheneck nach Beendigung der zweiten Bauphase entspricht im Wesentlichen noch dem heutigen Erscheinungsbild. Lediglich einige Nebengebäude – wie das Verbindungshaus und das Krankenhaus – wurden später abgerissen. Vom ehemaligen Kammergut hat sich bis ins Jahr 2025 kein Gebäude erhalten.
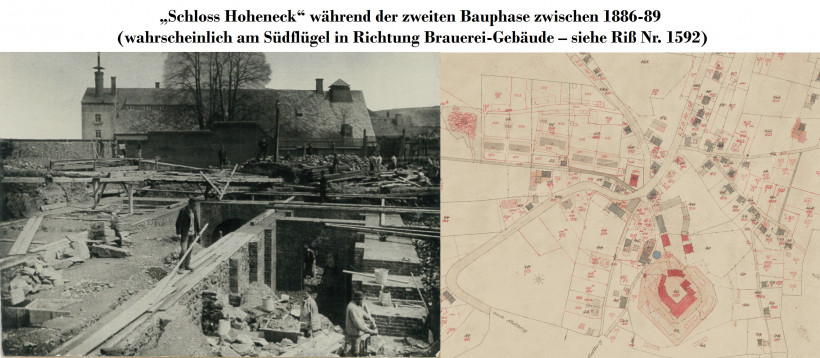
Abbildung 30: "Schloss Hoheneck" während der zweiten Bauphase zwischen 1886-89 (links Stadtarchiv Stollberg Bildarchiv Nr. 1.13 2/1538, rechts [P1883a])
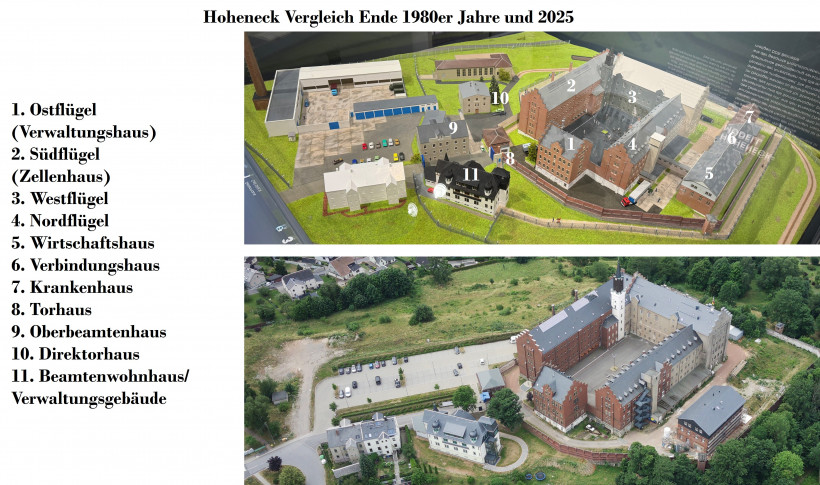
Abbildung 31: Hoheneck Vergleich Ende 1980er Jahre und 2025 (Hoheneck Modell Ende 1980er Jahre in der Gedenkstätte Hoheneck)
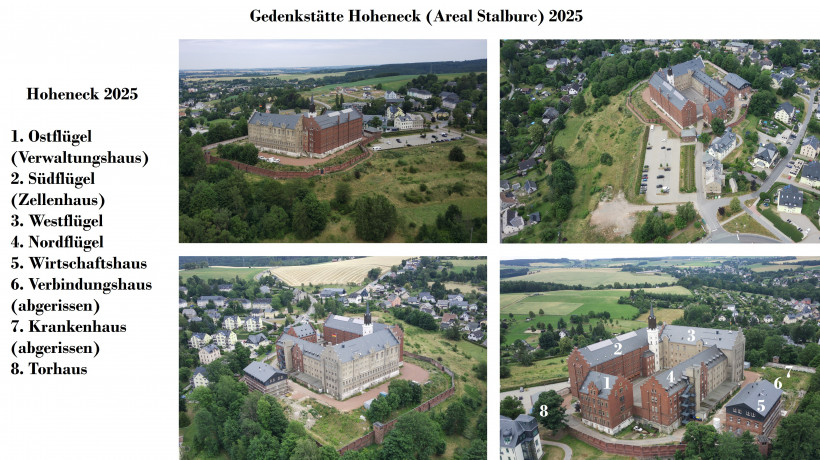
Abbildung 32: Gedenkstätte Hoheneck (Areal Stalburc) 2025 (eigene Darstellung)
Fazit/ Schlussbetrachtung
Methodik/ Ausblick/ Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit basiert überwiegend auf der Auswertung handschriftlicher Primärquellen aus dem Hauptstaatsarchiv Dresden sowie dem Staatsarchiv Chemnitz. Bereits vorhandene Sekundärliteratur wurde ebenfalls berücksichtigt und in ein Literaturverzeichnis aufgenommen, jedoch – aufgrund der häufig fehlenden Quellenangaben – nur in wenigen Ausnahmen in die Ausarbeitung einbezogen.
Die Analyse der Sekundärquellen legt nahe, dass nur ein geringer Teil der bisherigen Veröffentlichungen tatsächlich auf einer umfassenden Primärquellenforschung beruht. Unter den Arbeiten zur reinen Schlossgeschichte scheint vor allem Friedrich Schmidt [L1976_1978] intensiv Archivmaterial ausgewertet zu haben. Viele seiner historischen Angaben konnten durch die eigene Primärquellenanalyse bestätigt werden. Bedauerlicherweise hat Schmidt in seiner Veröffentlichung jedoch keine Quellenangaben hinterlassen.
Stand 26.08.2025 habe ich rund 132 Archivalien im Hauptstaatsarchiv Dresden und im Staatsarchiv Chemnitz mit einem Gesamtumfang von über 30.000 Seiten ausgewertet. Die behandelten Primärquellen aus den sächsischen Archiven decken den Zeitraum von 1563 (Ausnahme: Bergbuch von 1501) bis etwa 1900 ab.
Für eine umfassende Darstellung des Zeitraums 1863 bis 1889 ist jedoch eine zusätzliche Recherche erforderlich, insbesondere im Stadtarchiv Stollberg, im Kreisarchiv Erzgebirgskreis, im Archiv der Stiftung Sächsische Gedenkstätten Dresden sowie im Staatlichen Vermögens- und Hochbauamt Chemnitz. Diese weiterführende Arbeit konnte aus zeitlichen Gründen bislang nicht geleistet werden.
Alle Archivalien wurden während der Öffnungszeiten der jeweiligen Archive vor Ort per Smartphone vollständig digitalisiert. Die Digitalisate wurden anschließend rotiert und zugeschnitten und danach mittels HTR-Software (Handwritten Text Recognition) transkribiert. Als Endergebnis liegen sämtliche Archivalien in Form transkribierter PDF-Dokumente vor (jeweils mit Bild- und Transkriptionsseite) und konnten direkt für die Forschung ausgewertet werden.
Die Sekundärquellen bzw. Literatur wurden überwiegend aus der Stadtbibliothek Chemnitz sowie der SLUB Dresden bezogen und ebenfalls vollständig digitalisiert.
Bei der Auswertung der Pläne und Risse konnte auf eine umfangreiche Sammlung aus früheren, privaten Heimatforschungsprojekten zurückgegriffen werden. Diese Risse stammen überwiegend aus dem Hauptstaatsarchiv Dresden und wurden in den vergangenen neun Jahren für vorangegangene Projekte von mir digitalisiert – entweder persönlich vor Ort oder im Rahmen von Digitalisierungsaufträgen. Ergänzend wurden weitere Risse aus dem Landesamt für Denkmalpflege sowie dem Landratsamt Erzgebirgskreis bezogen.
Die historischen Bilder stammten größtenteils aus dem Stadtarchiv Stollberg. Besonderer Dank galt hierbei Frau Schreckenbach für ihre Unterstützung bei der Recherche. Viele aus der Literatur bekannte Abbildungen konnten in deutlich besserer Qualität aufgefunden und zudem bislang unbekannte Bilder in die Ausarbeitung einbezogen werden.
Die vorliegende Forschung zur Geschichte des Schlosses Stollberg wurde chronologisch aufgebaut und umfasst den Zeitraum von 1563 bis zur Umgestaltung zur „Königlich Sächsischen Landesanstalt“ im Jahr 1864. Zur besseren Einordnung der heutigen Bausubstanz des ehemaligen Gefängnisses Hoheneck wird die Baugeschichte nach dem Ende der Existenz des Schlosses Stollberg nach 1864 punktuell mit einbezogen.
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt jedoch eindeutig auf der Funktion des Schlosses Stollberg zwischen 1564 und 1864 als Verwaltungszentrum des kursächsischen Amtes Stollberg. Ziel der Anfertigung war es, ein vertieftes Verständnis für die historische Entwicklung des Schlosses zu erlangen, um auf dieser Grundlage künftig die Jagdgeschichte auf Schloss Stollberg unter Kurfürst August im 16. Jahrhundert fundierter bearbeiten zu können.
Ein thematisch angrenzendes Forschungsfeld bildet meine veröffentlichte Arbeit „Jagdstallungsriße im erweiterten Erzgebirgsraum“, die sich mit Inhalt und Aufbau der Jagdstallungsrisse im 16. Jahrhundert befasst. Langfristig soll die Forschung zur Geschichte des Amtes und Schlosses Stollberg in eine vertiefte Untersuchung der Jagdgeschichte im Amt Stollberg münden.
Neben der Erstellung von 3D-Modellen der unterschiedlichen Ausbaustufen habe ich versucht, die in den Quellen identifizierten Personen in einer chronologischen Übersicht zusammenzuführen – geordnet nach Vorwerks-/Kammergutspächtern, Schössern/Amtsschössern und Amtsmännern (siehe Anhang).
Der Verlauf der Pachtwechsel der Vorwerks- und Kammergutspächter lässt sich in den Quellen insbesondere unter der Kategorie „Inventare/Pachtverschreibungen Vorwerk“ gut nachvollziehen. Ziel der Auswertung dieser Quellenkategorie war es, die in den Archivalien enthaltenen Pachtverschreibungen und Inventare, die in der Regel beim Pächterwechsel des Kammerguts angefertigt wurden, vollständig und chronologisch zu erfassen.
In den Archivalien konnte eine Vielzahl von Inventaren (Inventarlisten) des Kammerguts und des Schlosses ermittelt werden. Diese wurden beim Erfassen und Bearbeiten der Quellen in zehn Inventargruppen eingeordnet. Im Anhang sind – aufgrund des großen Umfangs – lediglich die Oberkategorien dargestellt (in der Regel Räume und Gebäude, jedoch ohne detaillierte Objektbeschreibungen). Alle aufgefundenen Inventare wurden vollständig mit sämtlichen Objekten in einer Excel-Datei erfasst, die zu einem späteren Zeitpunkt an anderer Stelle veröffentlicht werden soll.
Bei der Recherche konnten zudem mehrere Ansichten und Risse zum Schloss und Kammergut ermittelt werden. Diese sind im Anhang chronologisch aufgeführt und zusätzlich georeferenziert im Geoportal Fergunna unter https://geoportal.fergunna.de/ abrufbar. Aufgrund seiner besonderen Bedeutung für die frühe Schlossgeschichte wird das Gutachten von Hans Irmisch aus dem Jahr 1573 ebenfalls vollständig im Anhang wiedergegeben.
Meinem verstorbenen Freund Rainer Hofmann gilt mein besonderer Dank. Unsere Gespräche über das Schloss Stollberg haben mich maßgeblich zur Erforschung seiner Geschichte motiviert – diese Arbeit ist auch seinem Andenken gewidmet.
Darüber hinaus danke ich meinen Freunden im Bergbauverein Thalheim e.V., die mich mit ihrem Probelesen, wertvollen Hinweisen und ihrer Motivation tatkräftig bei der Fertigstellung und Veröffentlichung dieser Arbeit unterstützt haben.
Vielen Dank für Ihr Interesse und Glück Auf
Michel Hilbert
Anhang
Schösser und Vorwerkspächter
Liste Pächter Vorwerk/ Kammergut
| Von | Bis | Vorwerkspächter |
|---|---|---|
| 1564 | 1567 | Paul Schober [V1567] - [V1568] |
| 1567 | 1584 | Andreas Kronberg [V1567][V1568]-[V1584] |
| 1584 | 1598 | Lorenz Stuler [V1584]-[V1598a][V1598b] |
| 1598 | 1602 | Paul Clausen [V1598a][V1598b]-[V1602][S1602] |
| 1602 | 1608 | Wolf von Breitenbach [V1602]-[S1602][V1608] |
| 1608 | 1614 | Elisabeth von Nitzschwitz (Witwe)[V1608]-[V1614] |
| 1614 | 1626 | Hans Hermann von Weißenbach [V1614]-[V1626] |
| 1626 | 1633 | Sebastian Metzschen/ Agnisen Metzschen (Witwe) [V1626]-[V1633a][V1633b][V1633c][V1633d][V1633e][V1633f] |
| 1633 | 1670 | Verpfändet an: Rudolf von Vitzthum zu Apolda und Heinrich Hildebrandt von Einsiedel zum Scharffenstein [V1633a][V1633b][V1633c][V1633d][V1633e][V1633f]-[V1640a][V1640b]-[V1670a][V1670b][V1670c] |
| 1670 | 1681 | Nicht verpachtet - Übergabe an Johan Georg Zimmerman und Johann Jacob Drummer (Schösser) - Als Verwalter bis 1681 Michael Blüher [V1670a][V1670b][V1670c]-[V1681] |
| 1681 | 1682 | Carl von Goldstein[V1681] |
| 1682 | 1692 | Christian Pohle [V1682][V1687]-[V1693a] |
| 1692 | 1698 | Gottlob Pohle (Bruder)[V1693a]-[V1695] |
| 1698 | 1699 | Christian Friedrich Hausenmann (fol. 72r[Q1698b]) |
| 1732 | Michael Ebert (Stadtarchiv Stollberg Archivsignatur 212/5 um 1732) | |
| 1699 | 1736 | 1702 verkauft an: Gottlob Friedrich Nester (Amtmann) (fol. 16r bis 32v[V1699][V1705] ,fol. 80v - 81v [Q1698b]) - [Q1736a] |
| 1736 | 1752 | wahrscheinlich im Besitz der Erben von Gottlob Friedrich Nester[Q1752c] und evtl. verwaltet durch einen Verwalter (möglicherweise Michael Lasche), Kammergut bis 1752 im Besitz von Nester laut (fol 15r [Q1808a]) |
| 1752 | RÜCKKAUF DURCH DIE SÄCHSISCHE KAMMER[Q1752c] | |
| 1743 | 1753 | Michael Lasche (evtl. bereits seit 1743 laut fol. 8r [Q1753], fol. 28v [Q1753]) |
| 1753 | 1754 | Johann Gottlob Fischer[V1753] |
| 1754 | 1761 | Daniel Gottfried Lieben (Amtmann)[V1754] (Unterverpachtung an Johann Christian Haase fol. 44v[V1796a]) |
| 1761 | 1784 | Friedrich Amadeo Daniel Lieben (Amtmann) [Q1754b] |
| 1784 | 1796 | Johann Christoph Schubert [V1784a][V1790a] (seit ca. 1569 Unterpächter von Lieben[Q1790]) |
| 1796 | 180? | Johann Michael Reinholden und Johann George Reinholden [V1796a][V1796b] (Übergabe an Kreyßel unbekannt - auf jeden Fall vor 1807) |
| 180? | 1808 | Christian Lebrecht Kreyßel (fol 57v [Q1808b]) |
| 1808 | 1814 | Wilhelm Adolph Gestewitz ([V1808]) |
| 1814 | 1815 | Carl Friedrich Diersch [V1815] |
| 1815 | 1820 | Johann Gottlob Schmidt (fol 16v [Q1816]) |
| 1820 | 1845 | Friedrich Dürigen [V1820a][V1820b][V1820c][V1827a][V1833a] (Übergabe war 1820 laut fol. 109v [Q1815]) |
| 1845 | PRIVATISIERUNG/ VERKAUF, AB SOFORT ALS STAMMGUT BEZEICHNET | |
| 1845 | 1859 | Friedrich Dürigen |
| 1859 | 1868 | Christian Gotthold Lehm (Gastwirt bei Gasthof zur Sonne, Stammgut wird am 04.10.1859 von Dürigen an Lehm verkauft fol. 92v [Q1857], Erwähnung um 1863 fol. 19r [Q1863_1870], mindestens bis 1869 nachweisbar [Q1852_1870b] - wahrscheinlich um 1868 gestorben fol. 75v [Q1862_1888]) |
Liste Schösser / Amtsschösser (bis ca. 1700) / Amtsschreiber / Amtsverwalter
| VON | BIS | Schösser |
|---|---|---|
| 1564 | 1584 | Andreas Kronberg (war wahrscheinlich bereits vor 1567 Schösser und ab 1567 zusätzlich Pächter des Vorwerks)[S1584] |
| 1584 | 1598 | Lorenz Stuler [S1584]- [S1597] |
| 1598 | 1602 | Paul Clausen [S1597]- [S1602] |
| 1602 | 1608 | Wolf von Breitenbach [S1602] |
| 1608 | 1644 | Melchior Bluer/ Blüher (mindestens bis 1642, wahrscheinlich um 1644) |
| 1644 | 1670 | Johann Jacob Drummer (fol. 192 [Q1632_1658], mindestens 1670[V1670a][V1670b][V1670c]) |
| 1670 | 1680 | eventuell Michael Blüher (oder auch nur als Verwalter des Vorwerks) |
| 1681 | 1692 | Christian Pohle[V1681][V1687] |
| 1692 | 1698 | Gottlob Pohle (Bruder) [Q1687][V1693a][V1695] |
| 1698 | 1708 | Christian Friedrich Hausen/ Hausenmann[Q1698b] ( beschr. fol. 111v [Q1698c], fol. 13r [Q1699]) |
| 1708 | 1746 | Samuel Sehm (Seihmen) (/) (laut[V1699] ab 07.08.1708 als "Ambtsschreiber" genannt, bis 1736 alleinig als "Amtsverwalter" tätig, danach ab 1736 zusätzlich Pächter des Amtes Stollberg[V1736], um 1746 gestorben [Q1748]) |
Liste Amtsmänner
| VON | BIS | Amtmann |
|---|---|---|
| 1699 | 1736 | Gottlob Friedrich Nester |
| 1736 | 1761 | Daniel Gottfried Lieben (seit 1728 Beamter im Amt Stollberg, 1761 gestorben[Q1754b]) |
| 1761 | 1784 | Friedrich Amadeo Daniel Lieben (Sohn)[Q1754b][V1763][V1778] |
| 1784 | 1785 | Amtmann Dietrich vom Amt Grünhain (zusätzlich für Stollberg zuständig)[Q1790] |
| 1785 | 1820 | Christian Gottlob Kampens (Kempe) ([V1778][V1796a]fol. 73v [Q1796]) [Q1808b][Q1817] (fol. 14v [Q1818b])[Q1809_1819] |
| 1820 | 1840 | Johann Carl Ludwig Wankel (1810 Rentbeamter Wenkel neben Kampens fol. 19r [Q1809_1819]) (spätestens 1821 fol 109v [Q1815]) ("Justiz-Amtmann" fol. 10r [Q1820a]) letzte Erwähnung 1840 (fol. 60v [Q1838]) |
| 1840 | 1852 | Karl August Müller (Ersterwähnung ab 1840 als "Rentbeamter" fol. 85r [Q1838],"Rentamtmann" fol. 22v [Q1845a]) |
| 1843 | 1851 | Heinrich Eduard Benisch (parallel zum Rentbeamten Müller, Ersterwähnung fol. 72r [Q1843], "Justizamtmann" fol. 22v [Q1845a]) - Vertretung Amtsactuar Friedrich August Hartmann (seit 1843)[Q1848] |
| 1852 | 1854 | Konstin Rudolf Erns (Rentamtmann)[Q1852] |
| 1852 | 1860 | Guster Richardt Indenius (Beamter für das Justizamt - wahrscheinlich Justizamtmann - fol. 32v 1852[Q1852], 1854[Q1842_1856], 1860 Königliches Gerichtsamt Stollberg fol. 132r [Q1852_1870b]) |
| 1854 | 1856 | Bernhard Heinze (Rentamtmann)[Q1852] |
| 1856 | 1859 | Karl August Müller (Rentamtmann) 1856 fol. 258r [Q1852] |
| 1859 | 1863 | Carl Veser (Rentamtmann)[Q1852][Q1859] |
Inventare
Inventargruppe 1 "neues Haus" (Besitzungen des Amtsschössers im Schloss) - 1584[S1584], 1597[S1597] , 1602[S1602] und direkt nach dem Brand im Jahr 1602[S1618]
Nach dem Brand im Jahr 1602 nach Inventar[S1618] nur noch "1. In der Torstube", "2. Im Schreibstüblein oder Gewölbe daran", "3. Unter dem Torhaus" und "5. In der Küche" vorhanden.
| Nummer | gebäude |
|---|---|
| 1 bis 30 | neues Haus (wahrscheinlich mit Räumlichkeiten des "kleines Haus hinter den Amtsstuben") |
| 31 bis 33 | kleiner Turm/ Eckturm |
| 34 bis 41 | altes Haus |
| 42 | Badestube im Schlossgarten (1602[S1602] nicht vorhanden, jedoch weiterhin im Vorwerksinventar) |
| 43 | Turm/ Bergfried |
| 44 | Backstube (nur 1602[S1602] vorhanden) |
- "Im Schloß" 1584[S1584] / In der Torstube im "neuen Haus"[S1597][S1602][S1618]
- Ein/Im Schreibstüblein, "oder Gewölbe daran"[S1597][S1602]
- Unter dem Torhaus
- Vor der Küche
- In der Küche
- In der Kanzlei
- In beiden Kammern
- Vor dieser Stube im Eingang
- In der gemalten Stube ist der Herrn Kammerräte und des Herrn Jägermeisters Gemach (1584[S1584] zusätzlich der Küchenmeister)
- Im Gemach von Fürst/ Herzog Christian von Anhalt und Herzog Adam Wenzel von Deschen
- In der großen hölzernen Kammer
- In der großen weißen Kammer auf dem Saal
- Im Gemach des Kurfürsten von Sachsen
- Im Schlafgemach daneben
- Vor dem Gemach Meines gnädigen Herrn (M.G.H)
- Im Gemach der Kurfürstin von Sachsen
- Auf dem Gang oder im Kämmerlein daneben
- In der Schlafkammer der Kurfürstin von Sachsen
- Im Gemach von Christoff Kohlreutters
- Im Gemach der kurfürstlichen Leibjungen von Adel
- Auf dem Boden über dem Gemach von Meinem gnädigen Herrn (M.G.H)
- Auf dem Kornboden daneben
- Im Frauenzimmer, das vorher die große Stube genannt wurde
- Vor dieser Stube
- In der Schlafkammer des Frauenzimmers
- Im Speisesaal oder Hofstube
- In der Kammer der Kammerräte und des Jägermeisters (1584[S1584] zusätzlicher der Oberküchenmeister)
- In der ersten Truchsess Kammer (Küche, Vorratsraum oder für das Küchenpersonal)
- In der anderen Truchsess Kammer
- Vor dieser Kammer
- Über dem kleinen Turm, im Gemach von D. Kohlreutter und D. Salmuth
- Auf dem Boden darüber
- Auf dem Haferboden
- Im alten Haus im Dach vor der Treppe (1584[S1584] nicht vorhanden)
- Am Giebel auf dem alten Haus zum Viehhof hin (1584[S1584] nicht vorhanden)
- In der Kirche
- In der Silberkammer
- In den beiden hinteren Gewölben
- Im Zehrgarten oder in dem vorderen Gewölbe (Gewölbe mit Speisevorräten)
- Vor dem Keller
- Im Keller
- In der Badestube im Garten (1602[S1602] nicht mehr vorhanden)
- Auf dem Turm[S1584] und am Turm im Schloss
- In der Backstube (nur 1602[S1602] vorhanden)
Inventargruppe 2a "altes Haus" (Besitzungen des Vorwerkspächters im Schloss) - 1626[S1626], 1633[S1633a][S1633b][S1633c][S1633d][S1633e][S1633f], 1640[S1640a][S1640b]
Inventar "altes Haus" wird ab 1626 dem Inventar des "Vorwerks" nachgestellt, da sich beide mit den Besitzungen des Vorwerkspächters beschäftigen.
| Nummer | gebäude |
|---|---|
| 1 bis 14 | altes Haus |
| 15 | kleines Haus hinter den Amtsstuben |
- am rauen oder großen Haus im Eingang zu rechten Hand ("welches die Rechtinhaberin gebraucht" [S1640a])
- In der ersten Stube im anderen Geschoss über den Kellern und Gewölben
- Vor dieser Stube (Eine Tür vor der Küche)
- Vor der Kammer auf der rechten Hand neben solchem Secret (Abritt)
- In der anderen Kammer direkt darüber
Im dritten Geschoss
- In der ersten Stube über der ehemaligen (Bohr-)Kirche
- In solcher Kammer (angrenzend zur vorhergehenden Stube)
- In der anderen Stube
- In der Kammer (angrenzend zur vorhergehenden Stube)
- In der dritten oder großen Stube, nach dem Melzhaus oder Vorwerk zu
- In solcher Kammer (angrenzend zur vorhergehenden Stube)
- Vor dieser Stube auf dem Saal
- Über solchen Gemächern (Boden, bspw. Getreideboden)
- Unter solchem Gebäude (großer langer Keller und ein ebenso großes langes Gewölbe darüber)
- Auf der anderen Seite unter dem kleinen Haus hinter der Amtsstube (große gewölbte Küche)
Inventargruppe 2b "altes Haus" (Besitzungen der Vorwerkspächters im Schloss) - 1670[S1670a][S1670b][S1670c]
| Nummer | gebäude |
|---|---|
| 1 bis 20 | altes Haus |
| 21 bis 30 | sonstiges |
Inventar "altes Haus" wird ab 1626 dem Inventar des "Vorwerks" nachgestellt, da sich beide mit den Besitzungen des Vorwerkspächters beschäftigen.
- An und auf dem großen Hause im Schlosse (Im Eingang)
- Vor solchem Gewölbe (ein kleines Gewölbe)
- Keller (langer Keller, hinterer Keller)
- Im anderen Geschoss (Tür vor der steinernen Treppen)
- Auf dem Saal
- In der ersten und unteren Stube
- In der Kammer
- In der Küche
- In der Kammer daran
- In der anderen Kammer
- In der alten Kirche
- Im oberen Geschoss
- erste Stube gegen das Vorwerk (Zwei Stuben etwas zugerichtet)
- Kammer daran
- Andere Stube gegen der Stadt zu
- Kammer daran
- Noch eine Kammer
- Auf dem Boden/ Böden (Drei Getreide Böden übereinander, erster großer Boden)
- Gegen solchem Boden dem Vorwerk zu
- Auf dem anderen und dritten Boden (Korn, Weizen, Hafer…)
- Getreide Maas
- Im vorderen Schlosshof (großes Gewölbe auf der linken Hand, große Küche hinter der Amtsstube und ein Gewölbe daran)
- An Getreide Säcken
- An Körben, Sieben und Mulden (Wannen/ Troge)
- An Heu und und Grummet (weitere Grasschnitt) Walp(urgis) 1670 noch vorhanden gewesen
- An Stroh Walpurgis 1670 noch vorhanden gewesen
- Auf der Schäferei im Eingang (altes Schäfers Wohnhaus, großer langer steinerer Schafstall, Thor zum Hof…)
- Schafstall
- Röhrwasser und Wasserhaus
- Grummet (Grassschnitt) Schuppen
- An Dachungen/ Dächern
- Dachleutern (Schlagbäume)
- Gärten (u. a. Einer im Schloss, Einer vor dem Schloss, einer auf dem Graben und einer beim Landknechts Häusel)
Inventargruppe 3a "Vorwerk" (Besitzungen des Vorwerkspächters im Vorwerk) - 1567[V1567], 1568[V1568], 1584[V1584], 1591 (Erbbuch)[V1591],1598[V1598a][V1598b], 1608[V1608], 1614[V1614],1626[V1626], 1633[V1633a][V1633b][V1633c][V1633d][V1633e][V1633f], 1640[V1640a][V1640b]
| Nummer | gebäude |
|---|---|
| 1 bis 20 | Gebäude/ Räumlichkeiten auf dem Vorwerksgelände |
| 21 - 24 | Gebäude/ Räumlichkeiten auf dem Schlossgelände (in Besitz des Vorwerkspächters) |
| 25 | Schäferei außerhalb des Vorwerksgeländes |
- Im Kuhstall
- An/ In der Viehstube
- Vor der Viehstube
- Über der Viehstube (auf dem Boden, Federbetten)
- Auf dem Kuhstall (erst ab Inventar [1614] vorhanden, laut Inventar [V1614] 1609 erbaut, Wohnfläche/ Betten)
- In der Knechtekammer (Wohnfläche/ Betten)
- In den beiden Kälberstellen
- In beiden Viehstellen (1640 nicht mehr vorhanden)
- Schweineställe (1640 nicht mehr vorhanden)
- Im Milchhaus
- Im Stüblein am Milchhaus
- Im Kämmerlein dabei
- Auf dem Boden über dem Käsehaus
- Im Brau- und Malzhaus
- Im Hopf- und Krautgarten (lediglich 1568 erwähnt)
- Röhrwasser
- Große Scheune
- Im Hof
- Kleine Scheune
- Heuschuppen (nur 1567 und 1568 vorhanden)
- Alte Badestube & Flachsheuslein (1567 und 1568 als zwei seperate Gebäude aufgeführt) / Badestube und Flachsheuslein (Inventare 1584 und 1598, demnach von Andreas Kronberger im Garten neu erbaut) / Die Badestube im Garten (Inventare 1608 - 1640) -> wahrscheinlich im Schloss und identisch mit "In der Badestube im Garten - Inventar neues Haus"
- Im Backhaus im Schloss (1567, 1569), In der Backstuben (1584-1598), nach 1598 nicht mehr erwähnt
- Im Keller (im Schloss)
- Über/ Vor dem Keller eine Speisekammer darinnen (1567 - 1608 danach nicht mehr vorhanden - wahrscheinlich beim Umbau des alten Hauses ab 1608 andersweitig benutzt)
- Schäferei
Vorwerk - Gebäude nach Inventar von 1567[V1567], 1568[V1568], 1584[V1584], 1591 (Erbbuch)[V1591],1598[V1598a], 1608[V1608], 1614[V1614],1626[V1626], 1633[V1633a][V1633b][V1633c][V1633d], 1640[V1640a]
- Kuhstall [V1567][V1568][V1584][V1626][V1633a][V1633b][V1633c][V1633d][V1640a]
- Viehstube (Vor der Viehstube, Über der Viehstube, In der Knecht Kammer)[V1567][V1568][V1584][V1591][V1598a][V1608][V1614][V1626][V1633a][V1633b][V1633c][V1633d][V1640a]
- Kälberställe ("beide")[V1567][V1568][V1584][V1591][V1598a][V1608][V1614][V1626][V1633a][V1633b][V1633c][V1633d][V1640a]
- Viehställe ("beide") [V1567][V1568][V1584][V1591][V1598a][V1608][V1614][V1626][V1633a][V1633b][V1633c][V1633d]einer[V1640a]
- Schweinestall/ Schweineställe[V1567][V1568][V1584][V1591][V1598a][V1608][V1614][V1626][V1633b][V1633c][V1633d]
- Milchhaus ("Stüblein am Milchhause", "Im Kemmerlein darbei")[V1567][V1568][V1584][V1591][V1598a][V1608][V1614][V1626][V1633a][V1633b][V1633c][V1633d][V1640a]
- Käsehaus (mit "Boden")[V1567][V1568][V1584][V1591][V1598a][V1608][V1614][V1626][V1633a][V1633b][V1633c][V1633d][V1640a]
- Brau- und Melzhaus[V1567][V1568][V1584][V1591][V1598a][V1608][V1614][V1626][V1633a][V1633b][V1633c][V1633d][V1640a]
- große Scheune[V1567][V1568][V1584][V1591][V1598a][V1608][V1614][V1626][V1633a][V1633b][V1633c][V1633d][V1640a]
- kleine Scheune[V1567][V1568][V1584][V1591][V1598a][V1608][V1614][V1626][V1633a][V1633b][V1633c][V1640a]
- Heuschuppen[V1567][V1568]
- alte Badestube[V1567][V1568] (zwischen 1567 und 1584 im Vorwerk abgerissen, im Schloss mit Flachsheuslein neu erbaut - siehe[V1591][V1598a])
- Flachsheuslein[V1567][V1568] (zwischen 1567 und 1584 im Vorwerk abgerissen, im Schloss mit Badestube neu erbaut - siehe[V1591][V1598a])
- In der Backstuben[V1584][V1591][V1598a] (im Gegensatz zu 1567, 1568 jetzt ohne Zusatz "im Schloß")
- Schäferei (liegt außerhalb des eigentlichen Vorwerks)[V1567][V1568][V1584][V1591][V1598a][V1608][V1614][V1626][V1633a][V1633b][V1633c][V1633d]
Inventargruppe 3b "Vorwerk" (Besitzungen des Vorwerkspächters im Vorwerk) - 1670[V1670a][V1670b][V1670c]
- An Rindvieh
- An Schafvieh
- An Getreide auf dem Böden
- An Hopfen
- An Getreide Säcken
- An Thünger (Dünger?)
- An Graß- und Obstgärten (großer Garten hinter der Schäferei, Eyer Garten hinter dem Schloß gelegen, Bienengarten beim Forwerg hinter dem Brauhauß gelegen, Hopfgarten bei der Schäferei)
- vier kleine kleinet und Pflanzengärtlein (einer im Schloss, einer vor dem Schloss, einer auf dem Graben, einer beim Landkecht Häusel)
- Im Brauhause
- Im Malzhaus daran
- Im Viehhaus
- Vor und in solchem Kammern
- Unten im Viehhause bei der anderen Treppe
- Im Kuhstall im Eingang
- Wasserhaus (mit Röhrwasser)
- Im Back- und Milchhaus
- Über dem Kellerlein ein Gebäudlein (mit 2. Böden)
- Über solchem Gebäude des Back- und Milchhauses (Böden)
- Im ersten Kälberstall im Eingange
- Im anderen Kälberstall
- Im dritten Stalle
- Pferdestall
- Wagenschuppen
- Scheunen (kleine Scheune, große Scheune)
- Badestube oder Häuslein im Bienengarten
Inventargruppe 4 Schloss- und Vorwerksgebäude - 1681[V1681]
"Specification Waß bey der Churf. S. Commission die Übergabe des forwergs betrl. in 3. tagen auffgegangen"
Liste mit Gebäuden beschreibt hauptsächlich den Zustand der Dächer/ Ausbesserungsarbeiten:
- Im Schloße (hohes Haus, Tür zur alten Kirche)
- Auf dem kleinen Turm
- Auf dem kleinen Seyger daran
- Auf dem Kuhe und Pferdestall
- Auf dem kleinen Gewölbe und Kirchen Boden
- Auf dem Nieder Haus (Klein durchgestrichen)
- Auf den Mauern (? Kleindach?)
- Im Viehhof, das Viehhaus
- Das Malzhaus
- Das Keller Haus
- Auf dem Käse Haus
- Auf dem Kälber Stall
- Der Pferdestall
- Auf der kleinen Scheune
- Die große Scheune
- Die Pothstuben?
- Auf der Schäferei
- Auf dem großen Hofstalle
- Der kleine Stall
- Auf dem Keller Häusel
- Auf dem Grummetschuppen
Inventargruppe 5 Schloss- und Vorwerksgebäude - 1701 [V1701]
| Nummer | gebäude |
|---|---|
| 1 | Sonstige Besitzungen |
| 2 - 24 | Gebäude/ Räumlichkeiten auf dem Schlossgelände (in Besitz des Vorwerkspächters) |
| 25 - 31 | Gärten |
| 32 - 59 | Gebäude/ Räumlichkeiten auf dem Vorwerksgelände (Ausnahmen 34, 40, 42, 43, 45) |
- An Rindvieh/ Kälber/ Aussaat/ Getreide Säcke/ Heu und Grummet/ Vieh Stroh/ Seile
- Den Gebäuden (Auf dem Niederhause)
- Auf der anderen Seite im Eingang auf der linken Hand
- Über den Küchen (erste Stube?)
- In der Kammer daran
- In der anderen Stube
- In der anderen Kammer
- Vor diesem Stüblein nach dem Hofe zu
- Auf dem Gange vor solcher Stuben
- Gegen solcher Stuben über
- Vor solchen Küchen
- In der Küchen Kammer (enthält Tür zur Speisekammer)
- In der anderen Kammer neben der Küchen
- An und auf der Treppe nach dem Obern Geschoss zu (kleines Kämmerlein)
- Im andern Geschoß (ein klein Stüblein)
- Vor diesen Stüblein
- In der nähesten Kammer daran
- In der anderen Kammer
- In der dritten Kammer
- Vor dieser Kammer auf dem Gange
- Über solcher Kammer (u.a. Getreide Böden)
- Unten an solchen Gebäuden (kleiner Keller)
- Vor solchen Keller
- Im fördern Schloß Hofe (großes Gewölbe auf der linken Hand, große Küche hinter der Ambtsstube, Gewölbe daran, Wachhütte)
- Den Gras und Obstgärten
- Der große Garten (hinter der Schäferey gelegen)
- Eyer Garten (hinter dem Schloß und Scheunen gelegen)
- Bienen Garten (hinter dem Brauhauße gelegen, am Malzhaus/ Badestubenhause)
- Badestuben oder Häußlein im Bienengarten
- Der Hopfengarten
- Drei kleine Pflanzgärtlein (1x vorm Schloß gelegen, 1x auf dem Graben gelegen, 1x beim Landknecht Häusel gelegen)
- Im Brauhaus
- Im Malzhause daran
- An Scheun Sieben, Körben und Mulden
- An der Schäferei im Eingange (altes Haus des Schäfers, großer langer steinerner Schafstall)
- Im Schafstall
- Kellerhäuslein der Schäferei?
- Röhrwasser und Wasserhaus
- Hirten Häußlein
- Röhren Vorrat und Röhren Büchsen
- Grummet Schuppen (Heu)
- Die Dachung auf den zum Vorwerk gehörigen Gebäuden
- Auf dem Niederhauße
- Auf dem kleinen Gewölbe und Küchen Boden
- Dachleithern/ Schlagbäume/ Holzvorrat
- Im Viehhause
- Das kleine Stübel
- Im Milchhause
- Wasserhaus (neben dem Viehhause)
- Kellerhaus
- Das Back- Und Milchhaus
- Schweinestall
- Im ersten Kälberstall im Eingange
- Im anderen Kälberstall
- Im dritten Stall
- Im Heu- und Grummet Boden
- Pferdestall
- Wagenschuppen
- Scheunen (kleine Scheune, große Scheune)
Inventargruppe 6a Vorwerksgebäude - 1796 [V1796a]
A: An Wohnwirtschafts- und andern Gebäuden und Zubehörungen
- Das neue Wohnhauß oder Pächterwohnung und zwar 1.1 das Vorhauß nach der Hof Seite 1.2 Die Gesinde Stube 1.3 Die Wohnstube 1.4 Das Vorhauß auf der Giebel Seite 1.5 Das Gewölbe 1.6 Ein Behälniß unter der Treppe 1.7 die Küche (Tür zur Brandwein Kammer) 1.8 die Brandwein Kammer 1.9 die Kammer neben dem Stall 1.10 der Milchkasten 1.11 zwei Brandwein Öfen Am ersten Stockwerk 1.12 Eine Treppe auf den Boden 1.13 Ein Vorsaal 1.14 Eine Oberstube vorne heraus mit einer Tür zum Eingang (Tür in die kleine Stube und daran stoßende Kammer) 1.15 die nurbenannte kleine Stube (mit einer Tür nach den Vorsaal) 1.16 ein Kamin zu beiden Stuben Öfen 1.17 Eine Kammer neben der vorgedachten großen oberen Stube (Tür zur nächsten Kammer) 1.18 neben an befindliche Kammer (Tür nach den Vorsaal) 1.19 zwei neben einander befindliche Kammern 1.20 der Abtritt 1.21 Der sogenannte Feuerofen Kammer (Tür zum hiteren Ausgang) 1.22 Eine Kammer an den Oberboden 1.23 Ein Fenster bei der Oberboden Treppen 1.24 Eine Tür und hölzerne Treppe zum Heuboden auf den Oberboden Im zweiten Stockwerk 1.25 Ein verschlagener und gespinnten Oberboden 1.26 die sogenannte Mehlkammer 1.27 eine Kammer daneben 1.28 zwei gespinnte Oberböden 1.29 auf den ersten Boden ein Bretverschlag und eine gemauerte Räucherkammer
- der Kuhstall im angebauten Seitengebäude
- das mit Brettern verschlagene Wasserhaus (hinterm Wohnhaus)
- das Maltz Haus (1788 neu erbaut) 4.1 ein Maltz Darr 4.2 eine Maltz Leune unter dem Maltz Haus 4.3 der Getreide Boden 4.4 ein gespinnter Boden
- Brauhaus (welches an das Malzhaus angebaut und sich mit diesem unter einer Dachung befindet)
- Die Gähr Kammer (wohin aus dem Brauhaus)
- Ein neu erbauter Schafstall
- das quervorstehende Scheunen und Schuppen Gebäude, welches zwei Scheunen und einen Schuppen ethält
- der Zieg? Viehstall
- das alte Milchaus (als Holzschuppen genutzt, da der Milchkasten sich im neuen Wohngebäude befindet)
- das Backhaus
- der Bierkeller ist unter den alten Schloß Gebäuden (eine Tür in den darinnen befindlichen zweiten Kellern)
- der Bierkeller auf der Seite des Backhauses, darüber ein hälzernes Häußgen von 14. Ellen lang unf 3. Ellen breit
- Ein hölzerner Wassertrog im Hofe
B: An Grundstücken
- An Feldern
- An Wiesen
- An Gras und Obstgärten (großer Garten, Eyer Garten, Grätzgarten am Schafstall, Garten im Schloßhof, zwei Gärten vor dem Schloßhof)
- An Hopfenberg (Hopfgarten)
- An Huthungen (umb alt Schloß 1/2 Ruthe)
- An Teichen (Ententeich im Hof, Waschwiesen Teich)
C: den sämtlichen Viehstand (Schaf, Rindvieh, Pferde, Federvieh)
D: An Wirtschafts und Ackergeräthe
E: An Bier, Frucht und anderen Voräten (Bier, Getreide, Saat, Hopfen, Äpfel, Heu, Holz, Asche)
F: An Feuer Geräthe
Inventargruppe 6b Vorwerksgebäude - 1828[V1828], 1833[V1833b]
A. An Wohn, Wirtschafts und anderen Gebäuden nebst Zubehör
- das Wohnhaus der Pächterwohnung mit einem Schindeldache und zwar a. das Vorhaus (nach der Hofseite) b. die Gesindestube c. die Wohnstube d. Das Torhaus an der Giebelseite e. das Gewölbe f. ein Behöltnis unter der Treppe g. die Küche h. die Brandweinkammer i. die Kammer neben dem Stalle k. die Milchkammer l. der Zuchtviehstall mit Schieferdachung Grummetboden (über Zuchtviehstall) Im ersten Stockwerke des Wohnhauses Abritt (angebaut und angeankert) Feueröffenkammer Im zweiten Stock Wasserhaus (hinter dem Wohnhause)
- das Malzhaus (Schieferdach)
- das Brauhaus (Schieferdach) die Gährkammer
- der neue Braugefäß und Sichschuppen
- der Schaffstall (Schindeldach)
- die neue Pforte (zwischen dem Schaffstall und dem neuen Wagenschuppen)
- der neue Gesinde Abtritt (zwischem dem unterm Geiebel des neuen Schuppen-Gebäudes und der anstossenden Hofmauer)
- der neue Wagen, Holz und Geschirr Schuppen a. Parterre (Wagenschuppen ohne Tor, 2. Schirrkammer, 3. kleiner Wagenschuppen) b. die Dach Etage
- das Scheun- und Schuppengebäude (mit Ziegeln und Schiefer gedacht)
- der neue Strohschuppen
- das neue Gebäude (neben dem Schaffstall, enthält Pferde-, Ochsen-, und Schweineställe und Brandweinbrennerei)
- das Backhaus (Ziegeldach)
- ein Keller Hof Vermachung (führt von dem Backhause zur Pächterwohnung)
- der Bierkeller (bei der Frohnveste linker Hand des Eingangs)
- der Bierkeller (bei der Frohnveste rechts des Eingangs)
B. Grundstücke
- An Feldern (a. niederer, b. mittlerer und c. oberer Quirlstein, d. Galgenholz, e. Vogelsteig, f. links/ g. rechts Thalheimer Straße, h. i. Schwemmteich, k. vorderer/ l. hinterer Mühlenberg, m. große und n. Dörnerstück, o. Schendberg, p. tiefe Garten, q. Hopfengarten, r. Hofmanns Guth, s. rechts/ t. links Heuweg, u. Lerchensteig, v. Hofmanns Felde, w. Epperleins/ x. Försters Gut, y. vorderer Grund, z. Waschwiese)
- An Wiesen (a. Hofwiese mit Wässerungswehren, b. die Waschwiese, c. die Schlucht, d. der Schenkberg, e. die Teichwiese, f. der tiefe Grund, g. der hintere und vordere Grund, h. drei Feldwiesen)
- An Gras und Obstgärten (a. der große Garten, b. der Eyergarten, c. der Platz vor der Frohnveste rechter Hand beim Eingang, d. das Gärtchen daselbst linker Hand)
- An Teichen (Ententeich im Hof, Waschwiesenteich, alte/ kleine Schwemmteich, Straßenteich, Heuteich, schwarze Teich)
C. Inventarien Vieh (1. An Schaffvieh, 2. Rindvieh, 3. Pferden, 4. Federvieh)
D. Wirtschafts Ackergerähte Schiff und Geschirr
E. An Bier Getreide (1. Bier, 2. Getreide, 3. Hopfen und Malz, 4. vorrähtigen Heu und Stroh, 5. Holze, 6. Asche)
F. Feuergeräte
7 Übersicht Zerschlagung des Kammerguts 1845 - Bildung eines Stammgutes
A. Verzeichnis der zu dem aus dem Kammergute Hoheneck zu bildenden Hauptgute zu schlagenden Grundstücke und Gebäude, mit Berücksichtigung der Hohen Orts anbefohlenen Veränderungen wegen Parzelle 59. und der geringeren Breite der Wege zusammengestellt (fol. 11v [Q1844_1849a])
- Felder I. das kleine Stück vom Schenkberge beim großen Garten
von V. das große Stück an Schiefermüller Raine
von VI. das Stück von Freitags Grenze bis zur Schaaftreibe
von VII. das Stück am Hopfengarten
VIII. das Stück links der Thalheimer Straße
IX. das an der neuen Treibe oberhalb des vorigen Stücks
von X. das Stück beim Wieschen? an Schiefermüllers Raine
von XII. der vordere obere Pulvermühlenberg
XIII. das Stück vor dem Wieschen an der Thalheimer Straße
XIV. der vordere Pulvermühlenberg an der Teichwiese
XVI. das kleine Stück am Schwemmteiche
von XVII. das Viereck am Schwemmteiche (früher bei Parzelle 59)
von XVIII. das Stück unterm Lärchensteige (früher bei Parzelle 59)
XXXV. das erste Gewende des Quirlsteins
XXXVII das mittelste Gewende des Quirlsteins
- Wiesen
3 Die zwei Wiesenfläckchen im Felde VI
5 Das Wischen an der Thalheimer Straße
von 6 die Teichwiese
von 7 der hintere Grund (früher bei Parzelle 59.)
von 12 der obere Theil der Waschwiesen
von 13 der mittlere Theil der Waschwiesen
14 der untere Teil der Waschwiesen
- Gärten
von a. der große Garten
von b. der Eiergarten
c. das Gemüsegärtchen hinter dem neuen Schuppen
- Teiche
b. der Waschteich
c. der Schwemm- oder Straßenteich (früher die Parzelle 59)
d. der alte Schwemmteich
- Hutungen, Treiben und Ränder
A die jetzt als Hutung benutzte ehemalige Straße hinter dem großen Garten
B Die neue Treibe zum großen Stück
von D der Hutungsstreifen an der Thalheimer Straße auf der nördlichen Seite
- Gebäude
a. Zuchtviestall (Schieferdach)
b. Schaafstall (Schindeldach)
c. Gesindeabtritt,
d. der Wagen-, Holz- und Geschirrschuppen (Schieferdach)
e. das Scheunen und Schuppengebäude (Hofseite Ziegeldach, Hinterseite Schieferdach)
f. an die Scheune angebauter Strohschuppen (Pultdach mit Schiefer)
g. Lattenthor
B. Verzeichnis der mit der Braugerechtigkeit zu veräußernden Gebäude und Inventarien-Gegenstände (fol. 14r [Q1844_1849a])
- das Malzhaus (Schieferdach, a. Stübchen für den Brauer, b. die Malzdarre, c. die Malztenne, d. Getreideboden, e. Schwelchboden)
- Brauhaus (am Malzhaus anstoßend mit Schieferdach)
- Die Gährkammer (Boden über Brauhaus und Gährkammer)
- Der am oberen Giebel des Brauhauses angebaute Brau Gebäude und Pichschuppen (mit Kronenziegeldach)
Verzeichnis zu dem Dismenbrations-Plane des Kammerguts Hoheneck - A. Das zu bildene Gut 1. Feld, 2. Wiesen, 3. Gärten, 4. Teiche, 5. Hutungen, Treiben und Ränder, 6. Gebäude und Hofraum, B. Das Brauhaus mit Pichschuppen (siehe oben)
C. In Parzellen zu veräußernde Grundstücke (i.d.R. Feld oder Wiese) (fol. 21r [Q1844_1849a])
- der niedere Quirlstein, 2-4 ~, 5. das große Gewende des Quirlstein, 6. ~, 7. das große Gewende des Quirlstein, 8. das große Gemeinde des Quirlstein, 9. ~, 10. das große unmittelste Gewende des Quirlstein, 11. - 14. ~, 15. das Stück am Galgenholze an der Stollberger Grenze, 16. das. Stück am Galgenholze, an der Stollberger Grenze, 17. ~, 18. der oberste Teil vom Stück am Galgenholze, 19. - 22. ~, 23. das erste Gewende vom Stück am Galgenholze, 24. - 27. ~, 28. das zweite Gewende am Galgenholze, 29. - 30. ~, 31. der oberste Theil am Stück am Galhenholze, 32 - 33. ~, 34. das Dreieck an Hoffmanns Gute, 35. - 39. ~, 40. das Stück am Heuwege rechts, 41. das Stück am Heuwege rechts, 42. das Stück am Heuwege links, 43. - 44. ~, 45. zwischen dem Lärchen und Vogelsteige, 46. - 49. ~, 50. bei Franks Hause, 51. bei Stöhners Hause, 52. bei Försters Hause, 53. bei Uhligs Hause, 54. ~, 55. unterm Lärchensteige, 56. - 58. ~, 59. an der Thalheimer Straßen, 60. - 62. ~, 63. am hintern Stück am Vogelsteig, 64. am hintern Stück am Vogelsteig, 65. - 68. ~, 69. zwischen der Thalheimer Straße und dem Vorgelsteig, 70. ~, 71. zwischen der Thalheimer Straße und dem Vogelsteig, 72. - 73. ~, 74. das Feld an der Waschwiese, 75. - 76. ~, 77. im großen Garten, 78. - 79. ~, 80. an der Stollberger Chaussee in der Schlucht, 81. am Schenkberge an der Stollberger Chaussee, 82. - 83. ~, 84. am Schenkberge hinter Freitags Felde, 85. am Schenkberge beim neuen Weg, 86. - 88. ~, 89. zwischen dem neuen Wege und Schuberts Grenzen, 90. ~, 91. am Dörnerstück, 92. - 97. ~, 98. vom großen Stück am Schiefermüllers Raine, 99. - 102. ~, 103. zwischen dem neuen Wege in Schuberts Grenze und vom großen Stück an Schiefermüller Raine, 104. vom Stück beim Wieschen an Schiefermüller Raine 105. - 107. ~, 108. vom obern Pulvermühlenberge, 109. - 110. ~, 111. an unteren Pulvermühlenberge, 112. - 113. ~, 114. am schwarzen Teich, 115. am Stück an Freitags Grenze, 116. - 118. ~, 119. am Stück am Hopfengarten, 120. - 129. ~, 130. der an Christfried Wolf vermietehte als Obst und Grasgarten benutzte Theil von der Waschwiese, 131. der an Gottlob Schulze vermiethete Theil derselben Wiese, 132. der an Friedr. Glob Hofmann vermiethete als Obst und Grasgarten benutzte Theil der Waschwiese
D. Dem Staatsforst zu überweisende Grundstücke (fol. 32v [Q1844_1849a])
von XVIII. das Viereck am Schwemmteiche
XVIII. das Stück unterm Lärchensteige
XIX. das Stück zwischen dem Lärchen und Vogelsteige
XXI. das Stück am Heuwege links
XXII. das Stück am heuwege rechts
7 der hintere Grund
f. der Heuteich
H. der jetzt als Hutung benutzte Theil von der vordern Grundwiese
L. die Huthung an der Chaussee nach Zwönitz auf der südlichen Seite
E. Zur Verwendung für das Rentamt bestimmt (fol. 33v [Q1844_1849a])
von b. der Eiergarten
D. das Küchengärtchen an der Frohnveste
e. das neue Gramsegärtchen beim Brauhause
d. der Ententeich am Hofe
Gebäude
Hofraum, ind: Schweinehof
F. An den vormaligen Senator Kunis aus Stollberg zu vererbende Grundstücke bei Ablauf des Pachtcontracts mit dem Pächter Dürigen 1845 laut hoher Finanz Ministerial Verordnung (fol. 33v [Q1844_1849a])
von 1. die Schlucht
B. die ehemaligen Straßen
G. Wege und andere nutzlose Räume (fol. 34v [Q1844_1849a]) Die Chaussee von Stollberg nach Zwönitz, Die Straße von Hoheneck nach Thalheim, Der Weg von Stollberg nach Meinersdorf der bis auf 80 verbreite Wirtschaftsweg an Freitags Grenze, Die Gasse am großen Garten, Der bis auf 80 verbreiterte Mitteldorfer Hofeweg, Der Weg am Felde XXXVIIU und der Waschwiesen, Der Heuweg, Der nur 80 breite Weg von Mitteldorfer Hofewege nach Stollberg-Zwönitzer Chaussee, Der neue 80 breite Weg zwischen der Parzelle 69. und Parzellen 63 bis 68., Der neue 80 breite Weg von der Thalheimer Straße nach dem Lärchensteige bis zum Staatsforste, Der neu anzulegende Weg rain vorigen nach dem Vogelsteige, Der neue Weg vom Stollberger Meinersdorfer Wege bis zur Teichwiese, Der neue 80 breite Weg von der Thalheimer Straße nach dem vorigen Wege an der Teichwiese
Abbildungen/ Darstellungen/ Bilder
1. Schlussstein 1564 / 1887

Abbildung 33: Schlussstein am Ostflügel (Verwaltungsgebäude) 1564/ 1887 (eigene Darstellung)
2. Simon Hoffmann - Schloss Stollberg 1615 - Entwurf 1 (Umbaupläne nicht ausgeführt)
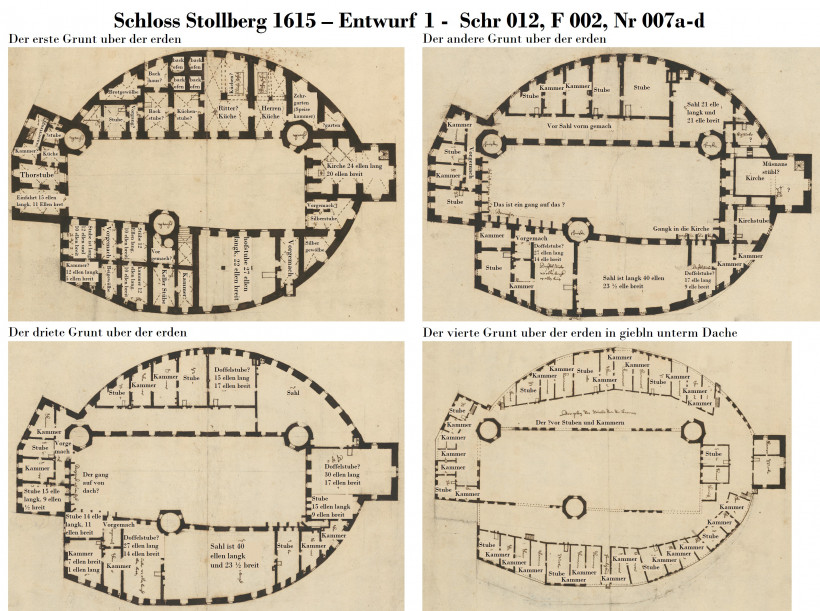
Abbildung 34: Simon Hoffmann erster Entwurf 1615 [P1615a]
Überblick historische Ansichten Schloss Stollberg
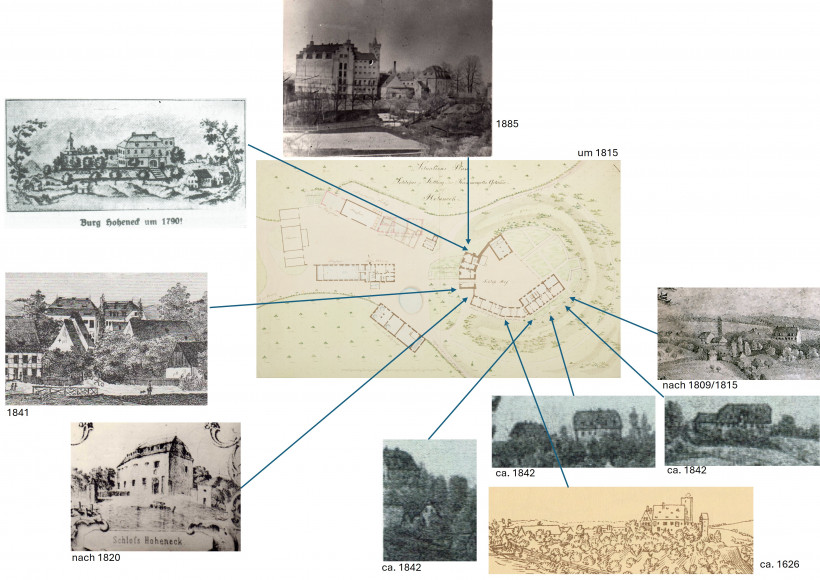
Abbildung 35: Schloss Stollberg aus unterschiedlichen Ansichten 1885 (Stadtarchiv Stollberg Bildarchiv Nr. 1.13 1093), 1790 (S. 7 [L2002] und Stadtarchiv Stollberg Bildarchiv Nr. unbekannt), 1841 (S. 109 [L1841]), nach 1820 um 1830 (Stadtarchiv Stollberg Bildarchiv Nr. 1.13 5/10239), 1842[L1842], 1626[P1626_1629], 1809/1815 (Stadtarchiv Stollberg Bildarchiv Nr. 1.01 249)
Kartenübersicht 1 - zwischen 1564 und 1790
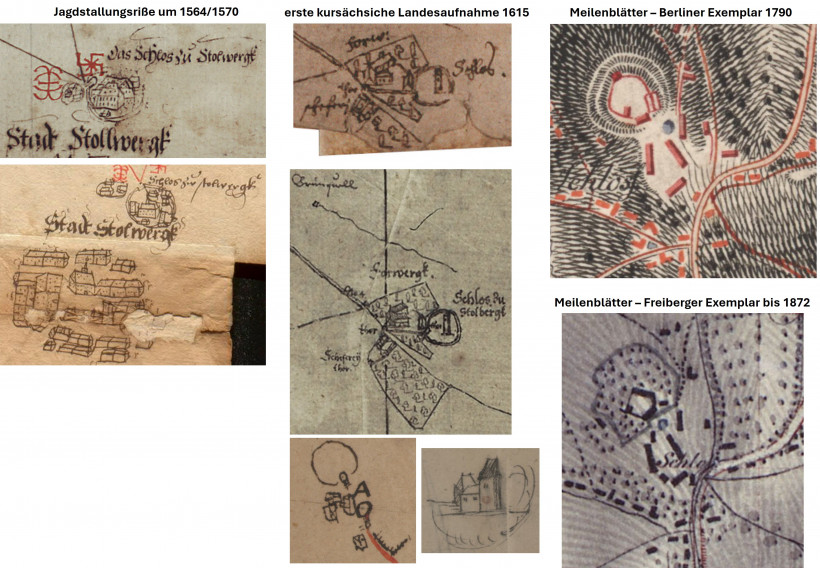
Abbildung 36: Kartenübersicht 1 1564/1570[P1570a][P1570b], 1615[P1615b][P1615c], 1790[P1790a], 1872[P1790b]
Kartenübersicht 2 - zwischen 1800 und 1825

Abbildung 37: Kartenübersicht 2 1798[P1798c], 1815[P1815a], 1815/1816[P1819c], 1817[P1817], 1819[P1819d], 1819[P1819a][P1819b], 1825[P1825]
Kartenübersicht 3 - zwischen 1857 und 1883
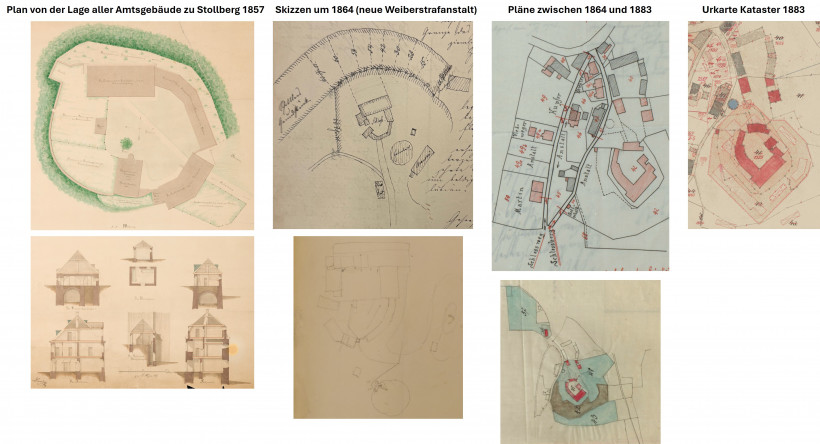
Abbildung 38: Kartenübersicht 3 1857[P1857], um 1864 [P1863a][P1863c], Pläne zwischen 1864 und 1883[P1876a][P1883b], 1883[P1883a]
Kartenübersicht 4 - zwischen 1875 und 1943
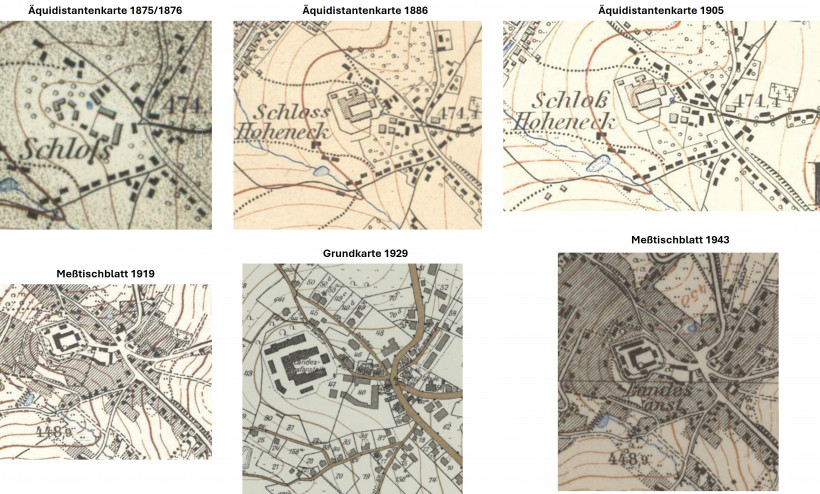
Abbildung 39: Kartenübersicht 4 1875[P1875a], 1886[P1886], 1905[P1905], 1919 (Hauptdatierung 1912)[P1919], 1929[P1929], 1943[P1943]
Kartenübersicht 5 - Riße zwischen 1864 und 1900 bei der Strafanstalt
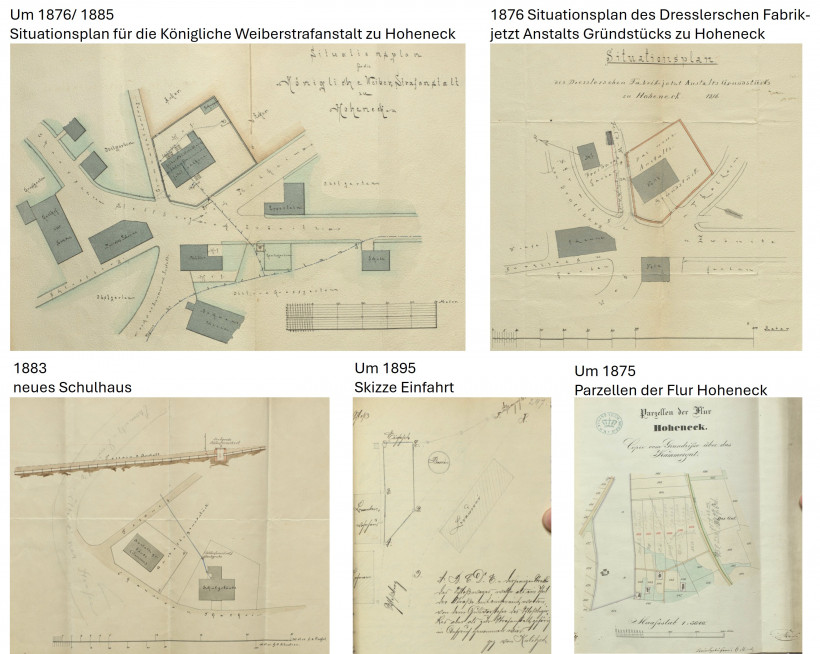
Abbildung 40: Kartenübersicht 5 1876/1885[P1876_1885], 1876[P1876b], 1883[P1883c], 1895[P1895], 1875[P1875b]
Sonstiges/ Quellen
Gutachten Schloss Stollberg Hans Irmisch 1573 - loc. 9126, Bausachen I, fol. 171 ff.
Zum ersten ist das alde hauß auf die rechte handt wan man ins schloß gehet 63 eln lang, 25 eln weytt und ist an der bedachung garr böse und kan dem anders nicht geholffen werden, man breche den schiefer ab und schaale es wiederumb new, weyll das wasser auch sehre durchgelauffen ist. So ist auch daneben zubesorgen, das die Palcken in der mauer verfaulet sein, welche auch müsten new gemacht werden. Deßgleichen etliche fußbodenn unnd decken, auch seindt die fenster nicht garr verglast, und gantz böse, und auch kein gutter kachelofen, düren, und schloß darinnen, muß solches alles zum mehren theyll new gemacht werden, undt seindt die gemach gar unordenlich in denselbigen haus,
was aber die ge- rissen meuern anlangett, habe ich vor vier jarren auch besichtigett und also befunden, wie sie itzonder stehen, wenn die Riesse wie- derumb ausgebessert und die meuren berabt werden, vorsehe ich mich keiner gefar, es mangelt denn an den grundten etwas, welche ich dismahl wegen des großen Sdhnees nicht habe besehen können, do aber je etwas doran befunden würde, so kan im doch wol ge- holffen werden, dan es stehen die mauren auff felß.
Zum dritten so ist an dem Neuen Hause ein helzern schnecken, in einen hölzern gang gefaßt, der hat sich gesetzt, das man sicher dorauff nicht gehen kan, So ist auch eine scheidewandt an der grossen stubenn, welche man das mußhaus nennet, die hat sich auch mit den underzogenn gesetzt, welche scheidewandt ich, beneben der schnecken hab ich den schösser bevohlen (!), er soll es steiffen lassen, das nicht weitter schaden geschieht, biß auf E. C. G. weitter befehlich.
Zum vierden ist der stall welcher hinder den dorm an der mauer stehett, gar verfaulett und eingefallen, deßgleichen die bedachung auff der wache ist an viel ordern böse und verfaulett, das auch itzidiger zeit auff dieselbigen bedachunge nicht wol an- schlech zu machen sein, dieweil man itzt für den schnee nicht wol besichtigen kan sonderlich die bedachung, so habe ich keinen richtigen anschlag machen können darauff, dieweil E. C. G. bedacht dieses hauß in besserung zu bringen, so se ich vor mein einfaldt vor gutt an E. C. G. liessen diß hauß im grundt mit allen gemachen aussreißen, wie es leidt, so kenden E. C. G. dorinnen ansehen, was E. C. G. für gemach dorinnen hette und was denn E. C. G. gned. dorinnen geliebt und gefellich zu bauen.
Quellen
Pläne und Risse
[P1570a]: Kurfürstliche Jagdstallungen im Amt Stollberg - Nr. 57 Übersichtsriß um 1570 (Sächsisches Staatsarchiv, 12884 Karten, Risse, Bilder, Nr. Schr 012, F 004, Nr 005)
[P1570b]: Die Stolberger Amtswaldungen um 1570 (Sächsisches Staatsarchiv, 12884 Karten, Risse, Bilder, Nr. Schr 001, F 012, Nr 002)
[P1615a]: Schloss Hoheneck Simon Hoffmann Pläne 1615 (Sächsisches Staatsarchiv, 12884 Karten, Risse, Bilder, Nr. Schr 012, F 002, Nr 007a-k)
[P1615b]: Gegend von Stollberg, Thum, Geyer, Zwönitz, Lössnitz, Stein und Wildenfels um 1615 (Sächsisches Staatsarchiv, 12884 Karten, Risse, Bilder, Nr. Schr 026, F 100, Nr 001)
[P1615c]: Landesaufnahme durch Matthias Öder und Balthasar Zimmermann - "Ur-Öder" Bl. 56 (Sächsisches Staatsarchiv, 12884 Karten, Risse, Bilder, Nr. Schr R, F 003, Bl 56)
[P1626_1629]: Darstellung Stollbergs zwischen 1626 und 1629 (Wilhelm Dilichs Federzeichnungen Erzgebirgischer und Vogtländischer Orte aus den Jahren 1626-1629 (Schwarzenberg: Glückauf-Verl., [1928])
[P1711_1742]: Atlas Augusteus Saxonicus Exemplar A 1711 - 1742 (Sächsisches Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv Dresden, 12884, Karten und Risse, Signatur/Inventar-Nr.: Makro 00633 & (Schr 001, F 013, Nr 010A))
[P1781]: Atlas Saxonicus Novus 1781 (Sächsisches Staatsarchiv, 12884 Karten, Risse, Bilder, Nr. Schr M, F 006, Nr 003)
[P1790a]: Meilenblatt Berliner Exemplar Blatt 200 um 1790 (http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70301497)
[P1790b]: Meilenblatt Freiberger Exemplar Blatt 189 Grundaufnahme 1790, Nachträge bis 1876 (https://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90011756)
[P1798a]: Archivalie [Q1797_1808]: Rößlerische Haus - Amtshaus am Markt (fol. 22r - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37343, Rep. 22, Stollberg, Nr. 0012)
[P1798b]: Archivalie [Q1797_1808]: Plan von dem Bertholdischen Hause und Gehöfte zu Stollberg (fol. 71r - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37343, Rep. 22, Stollberg, Nr. 0012)
[P1798c]: Archivalie [Q1797_1808]: geplanter Amtshausumbau des neuen Hauses (fol. 72r - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37343, Rep. 22, Stollberg, Nr. 0012)
[P1815a]: Situations Plan des Schlosses zu Stollberg u. der Kammerguths Gebäude auf Hoheneck um 1815 (LfDSN_PS_M39_II_Bl-003_r_Stollberg_SK - Landesamt für Denkmalpflege)
[P1815b]: Grundriss der Kammerguths Gebäude zu Hoheneck 1815 H. 120. (LfDSN_PS_M39_II_Bl-002_r_Stollberg_SK - Landesamt für Denkmalpflege)
[P1815c]: Bau Riß des neu zu erbauenden Pferde und Ochsenstalles auf dem Kammerguth Hoheneck bei Stollberg 174.99 H. 106. (LfDSN_PS_M39_II_Bl-001_r_Stollberg_SK - Landesamt für Denkmalpflege)
[P1815d]: Stollberg altes Amtshaus (Rößlerische Haus) 174.99 H. 125. (LfDSN_PS_M39_II_Bl-005-1_r_Stollberg_SK - Landesamt für Denkmalpflege)
[P1815e]: Stollberg altes Amtshaus (Rößlerische Haus) 174.99 H. 125. (LfDSN_PS_M39_II_Bl-005-2_r_Stollberg_SK - Landesamt für Denkmalpflege)
[P1817]: "Hoheneck" - Vermessung der Flur, Grund- und Aufriss der Gebäude, Zeichnung um 1817? - evtl. auch 1819 a. Kammergut Hoheneck, b. Thalheimer Wiese, c. Teiche/ Schwemmteich?, d. Schäferei?, e. nicht lieferbar/ nicht vorhanden, f. Vorwerksgebäude mit allen Etagen und Keller im Schloß g. Querschnitt Kammergutsgebäude (Sächsisches Staatsarchiv, 12884 Karten, Risse, Bilder, Nr. Schr 000, F 103, Nr 009a - g)
[P1819a]: Grundriss des Kammergutes Hoheneck - aufgenommen und gezeichnet in der Cameralvermesungs Anstalt des Königl. Sächs. geheimen Finanz Collegii im Jahr 1819 von Joseph Friedrich Tällmann - 1819 (Sächsisches Staatsarchiv, 12884 Karten, Risse, Bilder, Nr. Schr 035, F 000, Nr 002)
[P1819b]: Grundriss des königlich-sächsischen Kammerguts Hoheneck von Joseph Friedrich Tüllmann ca 1:9000 1819 (Sächsisches Staatsarchiv, 12884 Karten, Risse, Bilder, Nr. Schr 065, F 002, Nr 018, Bl 001)
[P1819c]: Grundriss des königlich-sächsischen Kammerguts Hoheneck (Sächsisches Staatsarchiv, 12884 Karten, Risse, Bilder, Nr. Schr 065, F 002, Nr 018, Bl 002)
[P1819d]: Archivalie [Q1819]: Grundriss des königlich-sächsischen Kammerguts Hoheneck (4 Riße zwischen fol. 168v und fol. 169r Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 39260, Rep. 62, Nr. 0247)
[P1825]: Thalheimer Revier, Spezialkarte Zellerholz (Sächsisches Staatsarchiv, 32693 Karten, Zeichnungen, Bilder, Nr. 481)
[P1838]: Menselblatt 7623USM1HE-1 Flur Hoheneck von Findeisen aufgenommen 1838 (Landratsamt Erzgebirgskreis)
[P1857]: Plan von der Lage der allen Amtsgebäude zu Stollberg - Quer-Durchschnitte von obigen sechs Gebäuden Baugerätheschuppen, Wasserhaus, Schuppengebäude, Amthaus, Holz- und Strohschuppen, Frohnveste gez. E. Hoyer 1857 (LfDSN_PS_M39_II_Bl-004_r_Stollberg_SK - Landesamt für Denkmalpflege)
[P1863a]: Archivalie[Q1863_1870]: Schloss Hoheneck als geplante Strafanstalt mit errichteten Westflügel und halben Nordflügel Skizze 1 1863 (fol. 1v - Sächsisches Staatsarchiv, 30068 Gefangenenanstalt Hoheneck, Nr. 18)
[P1863b]: Archivalie[Q1863_1870]: Croquis der Flur Hoheneck 1863 (fol. 17r - Sächsisches Staatsarchiv, 30068 Gefangenenanstalt Hoheneck, Nr. 18)
[P1863c]: Archivalie[Q1863_1870]: Schloss Hoheneck als geplante Strafanstalt mit errichteten Westflügel und halben Nordflügel Skizze 2 1863 (drittletzte Seite - Sächsisches Staatsarchiv, 30068 Gefangenenanstalt Hoheneck, Nr. 18)
[P1875a]: Section Stollberg aus: Topographische Karte (Äquidistantenkarte) Sachsen Datierung: 1875 Blatt 113 (https://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70302464)
[P1875b]: Archivalie[Q1875_1887]: Menselblattkopie Hasendorf "Parzellen der Flur Hoheneck" um 1875 (fol. 23r - Sächsisches Staatsarchiv, 30068 Gefangenenanstalt Hoheneck, Nr. 17)
[P1876a]: Archivalie[Q1876_1935]: Menselblattkopie um 1876 für Aufteilung Winterdienst am Schlossberg (fol. 44r, 77r und 90r Sächsisches Staatsarchiv, 30068 Gefangenenanstalt Hoheneck, Nr. 53)
[P1876b]: Archivalie[Q1876_1935]: Situationsplan des Dresslerschen Fabrik jetzt Anstalts Grundstücks zu Hoheneck (fol. 0r - Sächsisches Staatsarchiv, 30068 Gefangenenanstalt Hoheneck, Nr. 53)
[P1876_1885]: Archivalie[Q1884_1896]: Situationsplan für die Königliche Weiberstrafanstalt zu Hoheneck zwischen 1876 und 1885 (fol. 0v - Sächsisches Staatsarchiv, 30068 Gefangenenanstalt Hoheneck, Nr. 52)
[P1883a]: Flur Hoheneck (durchgestrichen) Stollberg 7623USN24 Urkarte des sächsischen Katasters Blatt 24 der Gemarkung Stollberg M 1 2000 gezeichnet 1883 (Landratsamt Erzgebirgskreis)
[P1883b]: Archivalie[Q1884_1896]: genaues Datum unbekannt - Skizze Schloss Hoheneck (fol. 0v - Sächsisches Staatsarchiv, 30068 Gefangenenanstalt Hoheneck, Nr. 52)
[P1883c]: Archivalie[Q1883_1911]: Plan neues Schulhaus um 1883 (fol. 53r - Sächsisches Staatsarchiv, 30068 Gefangenenanstalt Hoheneck, Nr. 56)
[P1886]: Äquidistantenkarte 113 : Section Stollberg, 1886 Blatt 113 (https://www.deutschefotothek.de/documents/obj/71056115)
[P1895]: Archivalie[Q1884_1896]: Skizze Einfahrt Schloss Hoheneck um 1895 (fol. 247r - Sächsisches Staatsarchiv, 30068 Gefangenenanstalt Hoheneck, Nr. 52)
[P1905]: Section Stollberg aus: Topographische Karte (Äquidistantenkarte) Sachsen Datierung: 1905 Blatt 113 (https://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70302464)
[P1919]: Section Stollberg aus: Topographische Karte (Meßtischblätter) Sachsen Datierung: 1912 Blatt 113 (https://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70302466)
[P1929]: [Deutsche Grundkarte] Freistaat Sachsen / Bearb. ... vom Sächsischen Landesvermessungsamt 113i : Stollberg/Erzgebirge, 1929 (https://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90065531)
[P1943]: Section Stollberg aus: Topographische Karte (Meßtischblätter) Sachsen Datierung: 1943 Blatt 113 (https://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70302466)
Inventare/ Pachtverschreibungen Vorwerk
[V1567]: Verpachtung des Vorwerks an Andreas Kronberg (ggf. Unterverpachtung an Friedrich von Oelsnitz und Bartel Lauterbach) 1567 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 32467, Rep. 20, Stollberg, Nr. 0001)
[V1568]: Übergabe des Vorwerks von Paul Schober an Andreas Kronberg 1568 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0001)
[V1584]: Übergabe des Vorwerks von Andreas Kronberg an Lorenz Stuler 1584 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 32467, Rep. 20, Stollberg, Nr. 0021)
[V1591]: Archivalie [Q1591a]: Forwergs Inventarium aus dem Erbbuch Datum unbekannt/ wahrscheinlich um 1591 (fol. 92r - 97r - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 38078, Rep. 47, Stollberg, Nr. 0004)
[V1598a]: Archivalie [Q1584_1626]: Übergabe des Vorwerks von Lorenz Stuler an Paul Clausen 1598 (fol. 18r bis 26r - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0003a)
[V1598b]: Archivalie [Q1584_1626]: Übergabe des Vorwerks von Lorenz Stuler an Paul Clausen 1598 (fol. 314r bis 321r - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0003a)
[V1602]: nicht überliefert - müsste jedoch die Übergabe von Paul Clausen an Wolf von Breitenbach beinhalten
[V1608]: Archivalie [Q1584_1626]: Übergabe des Vorwerks von Wolf von Breitenbach an Elisabeth von Nitzschwitz (Witwe) 1608 (fol. 113r bis 119v - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0003a)
[V1614]: Archivalie [Q1584_1626]: Übergabe des Vorwerks von Elisabeth von Nitzschwitz an Hans Hermann von Weißenbach 1614 (fol. 189r bis 198r - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0003a)
[V1626]: Archivalie [Q1584_1626]: Übergabe des Vorwerks von Hans Hermann von Weißenbach an Sebastian Metzschen 1626 (fol. 366r bis 378r - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0003a)
[V1633a]: Archivalie [Q1632]: Übergabe des Vorwerks von Agnisen Metzschen (Witwe)/ Sebastian Metzschen an Rudolf von Vitzthum zu Apolda und Heinrich Hildebrandt von Einsiedel 1633 (fol. 433r bis 440r - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0003b)
[V1633b]: Archivalie [Q1632]: Schadensinventar 30. jähriger Krieg Übergabe des Vorwerks von Agnisen Metzschen (Witwe)/ Sebastian Metzschen an Rudolf von Vitzthum zu Apolda und Heinrich Hildebrandt von Einsiedel 1633 (fol. 447r bis 454r - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0003b)
[V1633c]: Archivalie [Q1632]: Übergabe des Vorwerks von Agnisen Metzschen (Witwe)/ Sebastian Metzschen an Rudolf von Vitzthum zu Apolda und Heinrich Hildebrandt von Einsiedel 1633 (fol. 472r bis 485r - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0003b)
[V1633d]: Archivalie [Q1632]: Schadensinventar 30. jähriger Krieg Übergabe des Vorwerks von Agnisen Metzschen (Witwe)/ Sebastian Metzschen an Rudolf von Vitzthum zu Apolda und Heinrich Hildebrandt von Einsiedel 1633 (fol. 493r bis 497r - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0003b)
[V1633e]: Archivalie [Q1632_1658]: Übergabe des Vorwerks von Agnisen Metzschen an Rudolf von Vitzthum zu Apolda und Heinrich Hildebrandt von Einsiedel 1633 (fol. 42r bis 53r - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0004)
[V1633f]: Archivalie [Q1632_1658]: Schadensinventar 30. jähriger Krieg Übergabe des Vorwerks von Agnisen Metzschen (Witwe)/ Sebastian Metzschen an Rudolf von Vitzthum zu Apolda und Heinrich Hildebrandt von Einsiedel 1633 (fol. 60r bis 65r - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0004)
[V1640a]: Archivalie [Q1632]: Schadensinventar 30. jähriger Krieg des Vorwerks im Besitz von Rudolf von Vitzthum zu Apolda und Heinrich Hildebrandt von Einsiedel 1640 (fol. 518r bis 524v - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0003b)
[V1640b]: Archivalie [Q1632_1658]: Schadensinventar 30. jähriger Krieg des Vorwerks im Besitz von Rudolf von Vitzthum zu Apolda und Heinrich Hildebrandt von Einsiedel 1640 (fol. 148r bis 155r - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0004)
[V1670a]: Archivalie [Q1670]: Übergabe des Vorwerks von Herrn Christoph Vitzthum von Eckstedt (Erben?) und Herrn Heinrich Hildebrandts von Einsiedel Erben an Johan Georg Zimmerman und Johann Jacob Drummer (Schösser Stollberg) 1670 (fol. 86r - 92v - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37343, Rep. 22, Stollberg, Nr. 0014)
[V1670b]: Archivalie [Q1670]: Übergabe des Vorwerks von Herrn Christoph Vitzthum von Eckstedt (Erben?) und Herrn Heinrich Hildebrandts von Einsiedel Erben an Johan Georg Zimmerman und Johann Jacob Drummer (Schösser Stollberg) 1670 (fol. 100r - 109v - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37343, Rep. 22, Stollberg, Nr. 0014)
[V1670c]: Archivalie [Q1670]: Übergabe des Vorwerks von Herrn Christoph Vitzthum von Eckstedt (Erben?) und Herrn Heinrich Hildebrandts von Einsiedel Erben an Johan Georg Zimmerman und Johann Jacob Drummer (Schösser Stollberg) 1670 (fol. 120r - 136v - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37343, Rep. 22, Stollberg, Nr. 0014)
[V1681]: Übergabe des Vorwerks von dem Verwalter Michael Blüher an den Leutnant Carl von Goldsteinen für 6 Jahre 1681 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 32467, Rep. 20, Stollberg, Nr. 0023)
[V1682]: Archivalie [Q1698c]: Inventarium Vorwerk Übergabe an Amtsschösser Christian Pohle (fol. 56r bis 71v- Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37809, Rep. 43, Stollberg, Nr. 0012a)
[V1687]: Archivalie [Q1687]: Pachtschein/ Pachtverschreibung des Vorwerks für Schösser Christian Pohle von 1687 bis 1693 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0006)
[V1693a]: Archivalie [Q1687]: Pachtverschreibung des Vorwerks für Schösser Gottlob Pohle von 1692 bis 1695 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0006)
[V1693b]: Archivalie [Q1698c]: Specificatio Inventaris A Übergabe an Schösser Gottlob Pohlen um 1693 (fol. 30r bis 31v- Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37809, Rep. 43, Stollberg, Nr. 0012a)
[V1693c]: Archivalie [Q1698c]: Specificatio Inventaris B Übergabe an Schösser Gottlob Pohlen um 1693 (fol. 32r bis 31v- Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37809, Rep. 43, Stollberg, Nr. 0012a)
[V1695]: Archivalie [Q1687]: Pachtverschreibung des Vorwerks für Schösser Gottlob Pohle von 1695 bis 1701 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0006)
[V1699]: Archivalie [Q1699]: Pachtverschreibung über das Amt und Forwerg Stolberg (für 6 Jahre bis 1705) an Gottlob Friedrich Nestler 1699 (fol. 16r bis 32v - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0003c)
[V1701]: Übergabe des Vorwerks vom Schösser Gottlob Pohle an "Ambtmann" Gottlob Friedrich Nestler 1701 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 32467, Rep. 20, Stollberg, Nr. 0016)
[V1702a]: Verkauf des Vorwerks Stollberg (Schloß/ Forwergk/ Schäfferey und andere Gebäude) an Gottlob Friedrich Nester für 10.000 fl 03.04.1702 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37684, Rep. 43, Gen. Nr. 0036, Bl. 25)
[V1702b]: Tabella über die beym Königl. und Churf. Sächs. Amte Stolberg Anno 1701 seqq. veralienirten Cammer Güthere und Laaß-Stücken 1702 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37684, Rep. 43, Gen. Nr. 0040, Bl. 63)
[V1705]: Archivalie [Q1699]: Anderweitige Pachtsverschreibung über das Ambt Stollberg (für 6 Jahre bis 1711) an Gottlob Friedrich Nestler 1705 (nicht nummeriert - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0003c)
[V1712]: Archivalie [Q1699]: Pachtsverschreibung über das Ambt Stollberg (für 6 Jahre bis 1718) an Gottlob Friedrich Nester 1712 (263r bis nicht nummeriert - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0003c)
[V1718]: Archivalie [Q1699]: Anderweitige Pachtsverschreibung über das Amt Stollberg (für 6 Jahre bis 1724) an Gottlob Friedrich Nester 1718 (nicht nummeriert - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0003c)
[V1724]: Archivalie [Q1699]: Pachtsverschreibung übers Ambt Stollberg (für 6 Jahre bis 1730) an Gottlob Friedrich Nester 1724 (nicht nummeriert - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0003c)
[V1730]: Archivalie [Q1699]: Pachtsverschreibung übers Ambt Stollberg (für 6 Jahre bis 1736) an Gottlob Friedrich Nester 1730 (nicht nummeriert - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0003c)
[V1736]: Archivalie [Q1736a]: Pachtverschreibung über das Amt Stollberg (für 6 Jahre bis 1742) an den Amtsverwalter Samuel Sehm (Seihmen) 1736 (nicht nummeriert - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0017b)
[V1742]: Archivalie [Q1742]: Pachtverschreibung über das Amt Stollberg (für 6 Jahre bis 1748) an den Amtsverwalter Samuel Sehm (Seihmen) 1742 (nicht nummeriert - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0018)
[V1748]: Archivalie [Q1748]: Pachtverschreibung über das Amt Stollberg (für 6 Jahre bis 1754) an Amtmann Daniel Gottfried Lieben 1748 (nicht nummeriert - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0019)
[V1753]: Archivalie [Q1753]: Pachtverschreibung über das Camerguth Hoheneck (für 6 Jahre bis 1759) an Johann Gottlob Fischer 1753 (fol. 61v ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34058, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0030)
[V1754]: Archivalie [Q1754b]: Pachtverschreibung über das Amt Stollberg nebst dem CamerGuth Hoheneck auf Neun Jahre von 1754 bis 1763 an Amtmann Daniel Gottfried Lieben (für 9 Jahre) 1754 (fol. 94r ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34058, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0020)
[V1763]: Archivalie [Q1763]: Pachtsverschreibung über das Amt Stollberg nebst dem Cammer Guth Hoheneck auf neun Jahr von 1763 bis wieder dahin 1772 an Amtmann Friedrich Amadeo Daniel Lieben (fol. 30r ff. - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34058, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0021)
[V1772]: Archivalie unbekannt: Pachtsverschreibung über das Amt Stollberg nebst dem Cammer Guth Hoheneck auf sechs Jahr von 1772 bis wieder dahin 1778 an Amtmann Friedrich Amadeo Daniel Lieben
[V1778]: Archivalie [Q1778_1796]: Pachtverschreibung über das Amt Stollberg mit dem Cammerguthe Hoheneck auf 6 Jahre als von 1778 bis 1784 an Amtmann Friedrich Amadeo Daniel Lieben (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34058, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0029)
[V1784a]: Archivalie [Q1778_1796]: Pachts Verschreibung über das Cammerguth Hoheneck auf sechs Jahre als von Michaelis 1784 bis 1790 an Christoph Schubert (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34058, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0029)
[V1784b]: Archivalie [Q1790]: Pachts Verschreibung über das Cammerguth Hoheneck auf 6 Jahre von 1784 bis 1790 an Christoph Schubert (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34058, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0026)
[V1790a]: Archivalie [Q1778_1796]: Pachts Verschreibung über das Vorwerk Hoheneck auf Sechs Jahre von 1790 bis 1796 an Christoph Schubert (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34058, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0029)
[V1790b]: Archivalie [Q1796]: Pachts Verschreibung über das Vorwerk Hoheneck auf Sechs Jahre von 1790 bis 1796 an Christoph Schubert (fol. 74v ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34058, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0027)
[V1796a]: Inventar des Kammergutes Hoheneck 1796 bei der Übergabe von Christoph Schubert an Johann Michael Reinholden und Johann George Reinholden (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 32467, Rep. 20, Stollberg, Nr. 0018)
[V1796b]: Archivalie [Q1808a]: Pachtsverschreibung über das Kammerguth Hoheneck auf elf und dreiviertel Jahre von Michaelis 1796 an bis Johannis 1808 an Johann Michael Reinholden und Johann George Reinholden (Sohn) (fol. 166r ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34058, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0028)
[V1808]: Archivalie [Q1808b]: Pachts Verschreibung über das Cammerguth Hoheneck Sechs Jahre von Joh. 1808 bis dahin 1814 an Wilhelm Adolph Gestewitz (fol. 108r ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34059, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0033)
[V1815]: Archivalie [Q1816]: Pachtsverschreibung über das Cammerguth Hoheneck auf 5 Jahre von Johann 1815 bis dahin 1820 an Carl Friedrich Diersch (fol 115r ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34058, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0032b)
[V1820a]: Archivalie [Q1820b]: Pachtverschreibung über das Kammergut Hoheneck auf 7. Jahre von 1820 bis 1827 an Friedrich Dürigen (fol. 77r ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34059, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0034a)
[V1820b]: Archivalie [Q1820c]: Pachtverschreibung über das Kammergut Hohenck auf 7. Jahre von 1820 bis 1827 an Friedrich Dürigen (fol. 6v ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34059, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0034b)
[V1820c]: Archivalie [Q1820c]: Pachtverschreibung über das Kammergut Hohenck auf 7. Jahre von 1820 bis 1827 an Friedrich Dürigen (fol. 95 ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34059, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0034b)
[V1827a]: Archivalie [Q1815_1833]: Pachtverschreibung über das Kammergut Hoheneck auf die Zeit von Johannis 1827 bis 1833 an Friedrich Dürigen (fol 14r ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 36029, Rep. 08, Stollberg, Nr. 0013)
[V1827b]: Archivalie [Q1825b]: Pachtverschreibung über das Kammergut Hoheneck von 1827 bis 1833 an Friedrich Dürigen (fol. 43ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34060, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0036a)
[V1827c]: Archivalie [Q1825b]: Pachtverschreibung über das Kammergut Hoheneck von 1827 bis 1833 an Friedrich Dürigen (fol. 107ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34060, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0036a)
[V1827d]: Archivalie [Q1828a]: Pachtverschreibung über das Kammergut Hoheneck von 1827 bis 1833 an Friedrich Dürigen (fol. 64ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34060, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0036b)
[V1828]: Inventar des Kammergutes Hoheneck 1828 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 32467, Rep. 20, Stollberg, Nr. 0025)
[V1833a]: Archivalie [Q1815_1833]: Pachtverschreibung über das Kammergut Hoheneck auf die Zeit von Johannis 1833 bis dahin 1845 an Friedrich Dürigen (fol 23r ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 36029, Rep. 08, Stollberg, Nr. 0013)
[V1833b]: Inventar des Kammergutes Hoheneck 1833 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 32467, Rep. 20, Stollberg, Nr. 0026)
[V1833c]: Archivalie [Q1832b]: Pachtverschreibung über das Kammergut Hoheneck auf die Zeit von Johannis 1833 bis dahin 1845 an Friedrich Dürigen (fol. 81r ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34059, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0035a)
[V1833d]: Archivalie [Q1834]: Pachtverschreibung über das Kammergut Hoheneck auf die Zeit von Johannis 1833 bis dahin 1845 an Friedrich Dürigen (fol. 13r ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34059, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0035b)
[V1843]: Archivalie [Q1843]: Verzeichnis der Grundstücke des Kammerguts Hoheneck nach der Revision im Jahre 1843 zusammengestellt - A. Felder, B. Wiesen, C. Gärten, D. Teiche, E. Huthungen, Treiben und Rändern, Gebäude und Hofräume, Wege und andere nutzlose Räume (fol. 10r ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34060, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0035d)
[V1844a]: Archivalie [Q1844]: Verzeichnis der Grundstücke des zu dismembrirenden Kammerguts Hoheneck 1844 - A. Das zu bildende Gut, B. In Parzellen zu veräußernde Grundstücke, C. Dem Staatsforst zu überweisende Grundstücke, D. Zur Verwendung für das Rentamt bestimmt, E. An den vormaligen Senator Kunis aus Stollberg zu vererbende Grundstücke bei Ablauf des Pachtcontracs mit dem Pächter Dürigen, F. Wege und andere nutzlose Räume (fol. 13r ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37810, Rep. 43, Stollberg, Nr. 0017a)
[V1844b]: Archivalie [Q1844]: A: Verzeichnis der zu dem aus dem Kammergute Hoheneck zu bildenden Hauptgute zu schlagenden Grundstücke und Gebäuden - 1. Felder, 2. Wiesen, 3. Gärten, 4. Teiche, 5. Hutzungen, Gräserei und Ränder, 6. Gebäude (fol. 45r ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37810, Rep. 43, Stollberg, Nr. 0017a)
[V1844c]: Archivalie [Q1844]: Veräußerungsbedingungen bei der Parzellierung des Kammerguts Hoheneck (fol. 55r ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37810, Rep. 43, Stollberg, Nr. 0017a)
[V1844d]: Archivalie [Q1844]: A. Verzeichnis der zu dem aus dem Kammergute Hoheneck zu bildenden Hauptgute zu schlagenden Grunde und Gebäude mit Berücksichtigung der hohen Orts anbefohlenen Veränderungen wegen Parzelle 59 und der geringeren Breite der Wege - 1. Felder, 2. Wiesen, 3. (fol. 63r ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37810, Rep. 43, Stollberg, Nr. 0017a)
[V1844e]: Archivalie [Q1844]: B. Verzeichnis der mit der Braugerechtigkeit zu veräussernden Gebäude und Inventarien-Gegenstände (fol. 66r ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37810, Rep. 43, Stollberg, Nr. 0017a)
[V1844f]: Archivalie [Q1844]: Verzeichnis der von den Einwohnern zu Hoheneck an die dasige Kammergutspachtung alljährlich zu entrichtenden Erb- und Häusler Zinsen ingleichen Ablösungsrenten für Handfrohndienste, welche letztere im Jahr 1833 abgelöst worden sind (fol. 70r ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37810, Rep. 43, Stollberg, Nr. 0017a)
[V1845a]: Archivalie [Q1844]: Verzeichnis des durch die am 30. Juni und 1. Juli 1845 erfolgte öffentliche Versteigerung der bei dem Kammergute Hoheneck vorhandenen todten und lebenden Inventarien-Gegenstände gewonnenen Erlöses - 1. Schaafsvieh, 2. Rindvieh, 3. Pferde, 4. Federvieh, 5. Wirtschafts-Acker-Geräthe und Geschirre (fol. 162r ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37810, Rep. 43, Stollberg, Nr. 0017a)
[V1845b]: Archivalie [Q1844]: Verzeichnis des durch die Veräußerung der Getreide- und Grasnutzung … gewonnen Erlöse - A. von den an den Staatsforst, B. von den an den Rentbeamten (fol. 170r ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37810, Rep. 43, Stollberg, Nr. 0017a)
[V1846a]: Archivalie [Q1846]: Lehnschein Herrn Friedrich Dürigens über das aus dem früheren Kammergute gebildete Stammgut und den dazu gehörigen Gebäuden und Grundstücken für 825 Thaler (fol. 205v ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37810, Rep. 43, Stollberg, Nr. 0017b)
[V1846b]: Archivalie [Q1846]: Lehnschein des Gutsbesitzer Herrn Friedrich Dürigen zu Hoheneck über die Brauerei mit Pichschuppen und Braugerechtigkeit für 5000 (fol. 222r ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37810, Rep. 43, Stollberg, Nr. 0017b)
[V1846c]: Archivalie [Q1846]: Lehnschein für den Gasthofbesitzer Herrn Chrstian Gotthold Lehm in Hoheneck über 1 Acker 208 Ruthen Feld (fol. 233r ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37810, Rep. 43, Stollberg, Nr. 0017b)
[V1844_1849a]: Archivalie [Q1844_1849a]: Veräußerungsbedingungen bei der Parzellirung des Kammergut Hoheneck (fol. 4v ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 39261, Rep. 62, Nr. 0248a)
[V1844_1849b]: Archivalie [Q1844_1849a]: A Verzeichnis der zu dem aus dem Kammergute Hoheneck zu bildenden Hauptgute zu schlagenden Grundstücke und Gebäude, mit Berücksichtigung der Hohen Orts anbefohlenen Veränderungen wegen Parzelle 59. und der geringeren Breite der Wege zusammengestellt - 1. Felder 2. Wiesen 3. Gärten 4. Teiche 5. Hutungen, Treiben und Ränder 6. Gebäude (fol. 11v ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 39261, Rep. 62, Nr. 0248a)
[V1844_1849c]: Archivalie [Q1844_1849a]: B Verzeichnis der mit der Braugerechtigkeit zu veräußernden Gebäude und Inventarien-Gegenstände - 1. Malzhaus, 2. Brauhaus, 3. Gährkammer, 4. Braugebäude und Pichschuppen (fol. 14r ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 39261, Rep. 62, Nr. 0248a)
[V1844_1849d]: Archivalie [Q1844_1849a]: Verzeichnis zu dem Dismenbrations-Plane des Kammerguts Hoheneck - A. Das zu bildene Gut 1. Feld, 2. Wiesen, 3. Gärten, 4. Teiche, 5. Hutungen, Treiben und Ränder, 6. Gebäude und Hofraum, B. Das Brauhaus mit Pichschuppen, C. In Parzellen zu veräußernde Grundstücke, D. Dem Staatsforst zu überweisende Grundstücke, E. Zur Verwendung für das Rentamt bestimmt, F. An den vormaligen Senator Kunis aus Stollberg zu vererbende Grundstücke bei Ablauf des Pachtcontracts mit dem Pächter Dürigen 1845 laut hoher Finanz Ministerial Verordnung, G. Wege und andere nutzlose Räume (fol. 20r ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 39261, Rep. 62, Nr. 0248a)
[V1844_1849e]: Archivalie [Q1844_1849a]: Verzeichnis des durch die am 30. Juni und 1. Juli 1845 erfolgte, öffentliche Versteigerung der bei dem Kammergute Hoheneck vorhanden todten und lebenden Inventarien-Gegenstände, gewonnen Erlöses - I. Schaafvie, II. Rindvieh, III. Pferde, IV. Federvieh, V Wirthschafts-Acker-Geräte Schiff Geschirre, nicht txirte Inventarienstücke (fol. 126v ff - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 39261, Rep. 62, Nr. 0248a)
Inventare Schloss
[S1584]: Archivalie [Q1591a]: Inventar neues Haus - Übergabe von Schösser Andreas Kronberg an Lorenz Stuler 1584 (fol. 76r bis 85v - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 38078, Rep. 47, Stollberg, Nr. 0004)
[S1597]: Archivalie [Q1584_1626]: Inventar neues Haus - Übergabe von Schösser Lorenz Stuler an Paul Clausen 1597 (fol. 302r bis 312v - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0003a
[S1602]: Inventar neues Haus - Übergabe von Schösser Paul Clausen an Wolf von Breitenbach 1602 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 32467, Rep. 20, Stollberg, Nr. 0008a)
[S1612]: Extract von einem Inventar welches die Räumlichkeiten von der Vorwerkspächterin Elisabeth von Nitzschwitz im Schloss auflistet 1612 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0017a)
[S1618]: Archivalie [Q1591b]: Inventar neues Haus nach dem Brand im Jahr 1602 "Vorzeichnüs was am abgebrantten Schloß Inventario noch verhanden" - Datum unbekannt, ist bei Dokumenten des Jahres 1618 abgeheftet (fol. 127v bis 128r - Sächsisches Staatsarchiv, 30017 Amt Stollberg, Nr. 582)
[S1626]: Archivalie [Q1584_1626]: Inventar altes Haus - Übergabe Schlossräumlichkeiten des Vorwerkspächters Hans Hermann von Weißenbach an Sebastian Metzschen 1626 (fol. 380r bis 387v - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0003a)
[S1633a]: Archivalie [Q1632]: Inventar altes Haus - Übergabe Schlossräumlichkeiten des Vorwerkspächters Agnisen Metzschen (Witwe)/ Sebastian Metzschen an Rudolf von Vitzthum zu Apolda und Heinrich Hildebrandt von Einsiedel 1633 (fol. 440v bis 444r - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0003b)
[S1633b]: Archivalie [Q1632]: Inventar altes Haus - Schadensinventar 30. jähriger Krieg Übergabe Schlossräumlichkeiten des Vorwerkspächters Agnisen Metzschen (Witwe)/ Sebastian Metzschen an Rudolf von Vitzthum zu Apolda und Heinrich Hildebrandt von Einsiedel um 1633 (fol. 451r bis 454r- Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0003b)
[S1633c]: Archivalie [Q1632]: Inventar altes Haus - Übergabe Schlossräumlichkeiten des Vorwerkspächters Agnisen Metzschen (Witwe)/ Sebastian Metzschen an Rudolf von Vitzthum zu Apolda und Heinrich Hildebrandt von Einsiedel 1633 (fol. 485v bis 491r- Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0003b)
[S1633d]: Archivalie [Q1632]: Inventar altes Haus - Schadensinventar 30. jähriger Krieg Übergabe Schlossräumlichkeiten des Vorwerkspächters Agnisen Metzschen (Witwe)/ Sebastian Metzschen an Rudolf von Vitzthum zu Apolda und Heinrich Hildebrandt von Einsiedel um 1633 (fol. 497r bis 500r- Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0003b)
[S1633e]: Archivalie [Q1632_1658]: Inventar altes Haus - Übergabe Schlossräumlichkeiten des Vorwerkspächters Agnisen Metzschen (Witwe)/ Sebastian Metzschen an Rudolf von Vitzthum zu Apolda und Heinrich Hildebrandt von Einsiedel 1633 (fol. 53v bis 59r - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0004)
[S1633f]: Archivalie [Q1632_1658]: Inventar altes Haus - Schadensinventar 30. jähriger Krieg Übergabe Schlossräumlichkeiten des Vorwerkspächters Agnisen Metzschen (Witwe)/ Sebastian Metzschen an Rudolf von Vitzthum zu Apolda und Heinrich Hildebrandt von Einsiedel um 1633 (fol. 65v bis 68v - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0004)
[S1640a]: Archivalie [Q1632]: Inventar altes Haus - Schadensinventar 30. jähriger Krieg der Schlossräumlichkeiten im Besitz von Rudolf von Vitzthum zu Apolda und Heinrich Hildebrandt von Einsiedel 1640 (fol. 525r bis 528v - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0003b)
[S1640b]: Archivalie [Q1632_1658]: Inventar altes Haus - Schadensinventar 30. jähriger Krieg der Schlossräumlichkeiten im Besitz von Rudolf von Vitzthum zu Apolda und Heinrich Hildebrandt von Einsiedel 1640 (fol. 155r bis 159v - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0004)
[S1670a]: Archivalie [Q1670]: Inventar altes Haus - Übergabe Schlossräumlichkeiten von Herrn Christoph Vitzthum von Eckstedt (Erben?) und Herrn Heinrich Hildebrandts von Einsiedel Erben an Johan Georg Zimmerman und Johann Jacob Drummer (Schösser Stollberg) 1670 (fol. 93r - 98v - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37343, Rep. 22, Stollberg, Nr. 0014)
[S1670b]: Archivalie [Q1670]: Inventar altes Haus - Übergabe Schlossräumlichkeiten von Herrn Christoph Vitzthum von Eckstedt (Erben?) und Herrn Heinrich Hildebrandts von Einsiedel Erben an Johan Georg Zimmerman und Johann Jacob Drummer (Schösser Stollberg) 1670 (fol. 109r - 119v - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37343, Rep. 22, Stollberg, Nr. 0014)
[S1670c]: Archivalie [Q1670]: Inventar altes Haus - Übergabe Schlossräumlichkeiten von Herrn Christoph Vitzthum von Eckstedt (Erben?) und Herrn Heinrich Hildebrandts von Einsiedel Erben an Johan Georg Zimmerman und Johann Jacob Drummer (Schösser Stollberg) 1670 (fol. 137r - 145v - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37343, Rep. 22, Stollberg, Nr. 0014)
Schlossquellen allgemein
[Q1501]: Bergwerck uff der herrschafft Stolburgk vorliehen (Sächs. HStA Dresden, Rep. A 25a I, I Nr. 675)
[Q1563]: Ankauf des Gutes Stollberg mit der dortigen Stadt, den Dörfern, Gehölzen sowie allem Zubehör für 73.222 Gulden, 8 Groschen von denen von Schönberg 1563 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37343, Rep. 22, Stollberg, Nr. 0003)
[Q1563-1]: Das Gebeude auffm Schlos 1563 (fol. 13v - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37343, Rep. 22, Stollberg, Nr. 0003)
[Q1563-2]: Stolbergk das Schloß 1563 (fol. 28r - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37343, Rep. 22, Stollberg, Nr. 0003)
[Q1564_1568]: Pachtweise Überlassung des Vorwerkes Stollberg/Hoheneck an P. Schober (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0015)
[Q1573]: Gutachten Schloss Stollberg durch kurfürstlichen Baumeister Hans Irmisch 1573 (Sächsisches Staatsarchiv, loc. 9126, Bausachen I, fol. 171 ff.)
[Q1584_1626]: Verpachtung des Amtsvorwerkes und der Schäferei Stollberg/Hoheneck 1584 - 1626 [Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0003a]
[Q1591a]: Erbbuch des Amtes Stollberg 1591 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 38078, Rep. 47, Stollberg, Nr. 0004)
[Q1591a-1]: Eigenthümblicke Guetter des Amptes Stolbergk - An gebeuden 1591 (fol. 1r bis 1v - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 38078, Rep. 47, Stollberg, Nr. 0004)
[Q1591a-2]: Eigenthümblicke Guetter des Amptes Stolbergk - An forwergen 1591 (fol. 2r - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 38078, Rep. 47, Stollberg, Nr. 0004)
[Q1591a-3]: Eigenthümblicke Guetter des Amptes Stolbergk - An Gärten 1591 (fol. 5r - Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 38078, Rep. 47, Stollberg, Nr. 0004)
[Q1591b]: Berainung des Amtes Stollberg mit den Herren von Schönburg 1591 (Sächsisches Staatsarchiv, 30017 Amt Stollberg, Nr. 582)
[Q1610]: Forderung der Pächterin des Vorwerkes Stollberg/Hoheneck und des Schössers in Stollberg nach einer Wohnung im dortigen Schloss 1610 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0017a)
[Q1615]: Kostenanschlag für die Reparatur des Schlosses und des Vorwerkes des Vorwerkes Stollberg/Hoheneck 1615 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 36028, Rep. 08, Stollberg, Nr. 0001)
[Q1632]: Verpachtung des Amtsvorwerkes und der Schäferei Stollberg/Hoheneck 1632 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0003b)
[Q1632_1658]: Pachtweise Verschreibung des Vorwerkes Stollberg/Hoheneck an Rudolph von Vitzthum in Apolda und Heinrich Hildebrand von Einsiedel in Scharfenstein gegen ein Darlehen von 35.750 Talern 1632 - 1658 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0004)
[Q1644_1653]: Abrechnung über die pachtweise Verschreibung des Vorwerkes Stollberg an Rudolph von Vitzthum in Apolda und Heinrich Hildebrand von Einsiedel in Scharfenstein gegen ein Darlehen von 35.750 Talern 1644 - 1653 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37343, Rep. 22, Stollberg, Nr. 0013)
[Q1670]: Abrechnung und Vergleich mit Heinrich Hildebrand von Einsiedels Witwe Agnes, den Brüdern Friedrich Wilhelm und Christian Vitzthum von Eckstädt, mit Nicol von Gersdorf und mit Sophie Vitzthum von Eckstädt über ihre Forderungen an das Vorwerk Stollberg/Hoheneck 1670 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37343, Rep. 22, Stollberg, Nr. 0014)
[Q1672]: Nutzungsanschlag des Vorwerkes Stollberg/Hoheneck 1672 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34156, Rep. 06, Lit. S, Nr. 0039)
[Q1681]: Verpachtung des Amtsvorwerkes und der Schäferei Stollberg/Hoheneck 1681 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0005)
[Q1687]: Verpachtung des Amtsvorwerkes und der Schäferei Stollberg/Hoheneck 1687 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0006)
[Q1698a]: Vererbung des Vorwerkes Stollberg/Hoheneck mit allem Zubehör 1698 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37682, Rep. 43, Gen. Nr. 0020b, Bl. 009-015)
[Q1698b]: Vererbung des Vorwerkes Stollberg/Hoheneck mit allem Zubehör 1698 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37809, Rep. 43, Stollberg, Nr. 0003)
[Q1698c]: Vererbung des Vorwerkes Stollberg/Hoheneck mit allem Zubehör (Kommissionsakte) Bd. 01 1698 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37809, Rep. 43, Stollberg, Nr. 0012a)
[Q1698_1699]: Brauen, Ausschank und Ausschroten auf dem Vorwerk Stollberg/Hoheneck durch den Pächter Gottlob Pohle 1698-1699 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 41513, Rep. 59, Lit. D, Nr. 2596)
[Q1699]: Verpachtung des Amtsvorwerkes und der Schäferei Stollberg/Hoheneck 1699 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0003c)
[Q1701]: Vererbung des Vorwerkes Stollberg/Hoheneck mit allem Zubehör (Kommissionsakte) Bd. 02 1701 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37809, Rep. 43, Stollberg, Nr. 0012b)
[Q1731]: Verkauf des Schlosses und Vorwerks Stollberg 1731 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 31934, Rep. 33, Gen. Nr. 0350b, Stollberg, Bl. 029-043)
[Q1732]: Beschwerden und Klagen der brauenden Bürgerschaft gegen den Schloßvorwerkspächter Michael Ebert, wegen Aufrichtung einer neuen Schankstätte in dem sogenannten Viehause betr. 1732 (Stadtarchiv Stollberg, 212/5 1,5,112 B 272)
[Q1736a]: Verpachtung des Amtsvorwerkes und der Schäferei Stollberg/Hoheneck 1736 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0017b)
[Q1736b]: Vererbung des Vorwerkes Stollberg/Hoheneck sowie dessen steuerfreie Biere 1736 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37809, Rep. 43, Stollberg, Nr. 0008)
[Q1742]: Verpachtung des Amtsvorwerkes und der Schäferei Stollberg/Hoheneck 1742 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0018)
[Q1748]: Verpachtung des Amtsvorwerkes und der Schäferei Stollberg/Hoheneck 1748 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34057, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0019)
[Q1752a]: Extradition der im Gut Hoheneck erstandenen Dokumente und Akten (1702 - 1709) 1752 (Sächsisches Staatsarchiv, 30017 Amt Stollberg, Nr. 38)
[Q1752b]: Anlegung einer Landakziseeinnahme auf dem Schlossvorwerk Stollberg/Hoheneck 1752 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 33166, Rep. 52, Spec. Nr. 1610)
[Q1752c]: Extradition der im Gut Hoheneck erstandenen Dokumente und Akten (1702 - 1709) 1752 (Sächsisches Staatsarchiv, 30017 Amt Stollberg, Nr. 38)
[Q1753]: Verpachtung des Vorwerkes bzw. Kammergutes Hoheneck 1753 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34058, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0030)
[Q1754_1763]: Bau- und Reparaturkosten bei den Schlossgebäuden in Stollberg/Hoheneck 1754 - 1763 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 36028, Rep. 08, Stollberg, Nr. 0002)
[Q1754a]: Anlegung eines Beigeleites in der Schenke beim Kammergut Stollberg/Hoheneck 1754 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 39970, Rep. 15, Stollberg, Nr. 0012)
[Q1754b]: Verpachtung des Amtsvorwerkes und der Schäferei Stollberg/Hoheneck 1754 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34058, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0020)
[Q1758]: Vererbung eines Abschnittes der alten Straße beim Kammergut Stollberg/Hoheneck 1758 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37809, Rep. 43, Stollberg, Nr. 0010)
[Q1758_1808]: Vorschlag zur Vererbung der baufälligen Schenke beim Kammergut Stollberg/Hoheneck 1757 - 1808 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37809, Rep. 43, Stollberg, Nr. 0009)
[Q1763]: Verpachtung des Amtsvorwerkes und der Schäferei Stollberg/Hoheneck 1763 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34058, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0021)
[Q1768_1792]: Brache Baugrundstücke beim Kammergut Stollberg/Hoheneck 1768 - 1792 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 41202, Rep. 40, Nr. 0193)
[Q1771]: Vererbung des Hirten- und Schäferhauses beim Kammergut Hoheneck 1771 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37809, Rep. 43, Stollberg, Nr. 0011)
[Q1778_1796]: Verpachtung des Vorwerkes bzw. Kammergutes Hoheneck 1778 - 1796 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34058, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0029)
[Q1783]: Eigenmächtige Aneignung eines Abschnittes der alten Heerstraße, genannt "Schlucht" durch die Höckner'schen Erben in Stollberg 1783 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34843, Rep. 41, Stollberg, Nr. 0004)
[Q1790]: Verpachtung des Vorwerkes bzw. Kammergutes Hoheneck 1790 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34058, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0026)
[Q1796]: Verpachtung des Vorwerkes bzw. Kammergutes Hoheneck 1796 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34058, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0027)
[Q1797_1808]: Ankauf des Rößler'schen Hauses in Stollberg zur Einrichtung eines Amtshauses 1797 - 1808 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37343, Rep. 22, Stollberg, Nr. 0012)
[Q1808a]: Verpachtung des Vorwerkes bzw. Kammergutes Hoheneck 1808 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34058, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0028)
[Q1808b]: Verpachtung des Vorwerkes bzw. Kammergutes Hoheneck 1808 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34059, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0033)
[Q1808c]: Akten, den zwischen der brauenden Bürgerschaft allhier und dem Procuratur in Ansetzung des Bierauschrotens des Kammerguts Hoheneck entstandenen Differenz betreffend 1808 (Stadtarchiv Stollberg, 212/5 1,36,38 B 18)
[Q1809_1819]: Bau eines neuen Amtshauses in Stollberg 1809 - 1819 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 36029, Rep. 08, Stollberg, Nr. 0010)
[Q1814]: Verpachtung des Vorwerkes bzw. Kammergutes Hoheneck Bd. 01 1814 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34058, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0032a)
[Q1815]: Bau- und Reparaturmaßnahmen an den Gebäuden des Kammergutes Hoheneck Bd. 01 1815 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 36029, Rep. 08, Stollberg, Nr. 0012a)
[Q1815_1833]: Mitheranziehung der Pächter bei Bau- und Reparaturmaßnahmen an den Gebäuden des Kammergutes Hoheneck 1815 - 1833 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 36029, Rep. 08, Stollberg, Nr. 0013)
[Q1816]: Verpachtung des Vorwerkes bzw. Kammergutes Hoheneck Bd. 02 1816 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34058, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0032b)
[Q1817]: Verpachtung des Vorwerkes bzw. Kammergutes Hoheneck Bd. 03 1817 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34059, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0032c)
[Q1818a]: Verpachtung des Vorwerkes bzw. Kammergutes Hoheneck Bd. 04 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34059, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0032d)
[Q1819]: Vermessung und Veranschlagung des Kammergutes Hoheneck 1819 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 39260, Rep. 62, Nr. 0247)
[Q1818b]: Ankauf und Abriss der vier Tagelöhnerhäuser auf der Wiese "Vorderer Grund" des Kammergutes Hoheneck durch den Fiskus 1818 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 39261, Rep. 62, Nr. 0254)
[Q1820a]: Streitigkeiten zwischen dem Kammergut Hoheneck und dem Rat und der brauenden Bürgerschaft in Stollberg wegen des Bierausschankes auf dem Kammergut 1820 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 31983, Rep. 33, Spec.00Nr. 1901)
[Q1820b]: Verpachtung des Vorwerkes bzw. Kammergutes Hoheneck Bd. 01 1820 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34059, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0034a)
[Q1820c]: Verpachtung des Vorwerkes bzw. Kammergutes Hoheneck Bd. 02 1820 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34059, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0034b)
[Q1822]: Verpachtung des Vorwerkes bzw. Kammergutes Hoheneck Bd. 03 1822 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34059, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0034c)
[Q1825a]: Bau- und Reparaturmaßnahmen an den Gebäuden des Kammergutes Hoheneck Bd. 02 1825 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 36029, Rep. 08, Stollberg, Nr. 0012b)
[Q1825b]: Verpachtung des Vorwerkes bzw. Kammergutes Hoheneck Bd. 01 1825 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34060, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0036a)
[Q1827]: Verpachtung des Vorwerkes bzw. Kammergutes Hoheneck Bd. 04 1827 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34059, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0034d)
[Q1828a]: Verpachtung des Vorwerkes bzw. Kammergutes Hoheneck Bd. 02 1828 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34060, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0036b)
[Q1830]: Verpachtung des Vorwerkes bzw. Kammergutes Hoheneck Bd. 03 1830 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34060, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0036c)
[Q1832a]: Revision des Kammergutes Hoheneck als Grundlage für den im Jahr 1832 neu angefertigten Nutzungsanschlag 1832 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 31897, Rep. 37, Stollberg, Nr. 0015)
[Q1832b]: Verpachtung des Vorwerkes bzw. Kammergutes Hoheneck Bd. 01 1832 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34059, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0035a)
[Q1834]: Verpachtung des Vorwerkes bzw. Kammergutes Hoheneck Bd. 02 1834 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34059, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0035b)
[Q1836]: Bau- und Reparaturmaßnahmen an den Gebäuden des Kammergutes Hoheneck Bd. 03 1836 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 36029, Rep. 08, Stollberg, Nr. 0012c)
[Q1838]: Verpachtung des Vorwerkes bzw. Kammergutes Hoheneck Bd. 03 1838 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34060, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0035c)
[Q1840a]: Heranziehung des Kammergutes Hoheneck zu den Parochiallasten 1840 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 39260, Rep. 62, Nr. 0246)
[Q1840b]: Heranziehung des Kammergutes Hoheneck zur Aufbringung der Parochiallasten 1840 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 32550, Rep. 23, Stollberg, Nr. 0005)
[Q1840c]: Klage des Fiskus gegen den Pächter des Kammergutes Hoheneck, Friedrich Dürigen, wegen ausstehender Pachtgelder 1840 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 32056, Rep. 33, Spec. Nr. 2873)
[Q1842_1856]: Torwärterfunkion beim Amtshaus in Stollberg 1842-1856 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 36636, Rep. 52, Spec. Nr. 3243)
[Q1843]: Verpachtung des Vorwerkes bzw. Kammergutes Hoheneck Bd. 04 1843 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 34060, Rep. 29, Stollberg, Nr. 0035d)
[Q1844]: Verkauf des Kammergutes Hoheneck (Kanzleiakte) Bd. 01 1844 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37810, Rep. 43, Stollberg, Nr. 0017a)
[Q1845a]: Vertretung des Staatsfiskus bei Übergabe und Übernahme des Kammergutes Hoheneck 1845 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 32111, Rep. 33, Spec. Nr. 3454)
[Q1845b]: Fiskus gegen Lehm und andere Handwerker in Hoheneck wegen verweigerter Zahlung des Handwerksgeldes 1845 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 32128, Rep. 33, Spec. Nr. 3616)
[Q1846]: Verkauf des Kammergutes Hoheneck (Kanzleiakte) Bd. 02 1846 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37810, Rep. 43, Stollberg, Nr. 0017b)
[Q1848]: Verkauf des Kammergutes Hoheneck (Kanzleiakte) Bd. 03 1848 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37810, Rep. 43, Stollberg, Nr. 0017c)
[Q1844_1849a]: Verkauf des Kammergutes Hoheneck mit Zubehör und vierteljährliche Einsendung der Zinsen und Kaufgelder für die abgeteilten Grundstücke Bd. 01 1844 - 1849 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 39261, Rep. 62, Nr. 0248a)
[Q1844_1849b]: Verkauf des Kammergutes Hoheneck mit Zubehör und vierteljährliche Einsendung der Zinsen und Kaufgelder für die abgeteilten Grundstücke Bd. 02 1844 - 1849 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 39261, Rep. 62, Nr. 0248b)
[Q1852]: Verkauf des Kammergutes Hoheneck (Kanzleiakte) Bd. 04 1852 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37810, Rep. 43, Stollberg, Nr. 0017d)
[Q1853]: Freiwillige Intradenablösung in dem Stollberger Amtsdorf Hoheneck 1853 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 39259, Rep. 62, Nr. 0199a)
[Q1857]: Verkauf des Kammergutes Hoheneck (Kanzleiakte) Bd. 05 1857 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37810, Rep. 43, Stollberg, Nr. 0017e)
[Q1859]: Ansprüche des Staatsfiskus an das Vermögen des ehemaligen Rentamtmannes Müller in Hoheneck 1859 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 32316, Rep. 33, Spec. Nr. 6145)
[Q1852_1870a]: Vierteljährliche Einsendung der Zinsen und Kaufgelder für die abgeteilten Grundstücke des ehemaligen Kammergutes Hoheneck Bd. 01 1852 - 1870 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 39261, Rep. 62, Nr. 0249a)
[Q1852_1870b]: Vierteljährliche Einsendung der Zinsen und Kaufgelder für die abgeteilten Grundstücke des ehemaligen Kammergutes Hoheneck Bd. 02 1852 - 1870 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 39261, Rep. 62, Nr. 0249b)
[Q1859_1871]: Schloss Hoheneck 1859 - 1871 (Sächsisches Staatsarchiv, 30071 Zuchthaus Zwickau, Nr. 20057)
[Q1862_1888]: Wasserversorgung Bd. 1 (Sächsisches Staatsarchiv, 30068 Gefangenenanstalt Hoheneck, Nr. 37)
[Q1863_1870]: Erwerb von Grundstücken zum Zweck der Errichtung einer Weiberstrafanstalt auf Schloss Hoheneck 1863 - 1870 (Sächsisches Staatsarchiv, 30068 Gefangenenanstalt Hoheneck, Nr. 18)
[Q1864_1874]: Einrichtung der Strafanstalt Bd. 1 1864 - 1874 (Sächsisches Staatsarchiv, 30068 Gefangenenanstalt Hoheneck, Nr. 55)
[Q1865_1899]: Anlegung eines Friedhofs für die Strafanstalt Hoheneck Bd. 1 (Sächsisches Staatsarchiv, 30068 Gefangenenanstalt Hoheneck, Nr. 50)
[Q1866_1870]: Erwerb von Grundstücken zum Ausbau der Landesanstalt Hoheneck 1866 - 1870 (Sächsisches Staatsarchiv, 30068 Gefangenenanstalt Hoheneck, Nr. 19)
[Q1875_1878]: Erwerb von Grundstücken zum Ausbau der Landesanstalt Hoheneck Bd. 4 1875 - 1878 (Sächsisches Staatsarchiv, 30068 Gefangenenanstalt Hoheneck, Nr. 20)
[Q1875_1887]: Erwerb von Grundstücken zum Ausbau der Landesanstalt Hoheneck Bd. 1 1875 - 1887 (Sächsisches Staatsarchiv, 30068 Gefangenenanstalt Hoheneck, Nr. 17)
[Q1876_1935]: Herstellung und Unterhaltung der zur Anstalt führenden Straßen und Wege 1876 - 1878, 1907 -1935 (Sächsisches Staatsarchiv, 30068 Gefangenenanstalt Hoheneck, Nr. 53)
[Q1876]: Verkauf des Kammergutes Hoheneck (Kanzleiakte) Bd. 06 1876 (Sächsisches Staatsarchiv, 10036 Finanzarchiv, Nr. Loc. 37810, Rep. 43, Stollberg, Nr. 0017f)
[Q1879_1882]: Erwerb von Grundstücken zum Ausbau der Landesanstalt Hoheneck Bd. 5 1879 - 1882 (Sächsisches Staatsarchiv, 30068 Gefangenenanstalt Hoheneck, Nr. 23)
[Q1883_1911]: Grundbesitz der Anstalt Bd. 1 1883 - 1911 (Sächsisches Staatsarchiv, 30068 Gefangenenanstalt Hoheneck, Nr. 56)
[Q1884_1896]: Gutsbezirksangelegenheiten Bd. 2 (Sächsisches Staatsarchiv, 30068 Gefangenenanstalt Hoheneck, Nr. 52)
Literatur
Schloss Stollberg
[L1824]: "Schloss Stollberg" S. 438 in Vollständige Staats-, Post- und Zeitungslexikon von Sachsen "Band 1824: Schweitz – Trebishayn" von August Schumann
[L1839]: "Das Amt Stollberg" S. 92 bis S. 96 in Handbuch der Geographie, Statistik und Topographie des Königreiches Sachsen 1839 von Albert Schiffner
[L1841]: "Hohneck bei Stollberg" in Sachsen in Bildern 1841 von Friedrich Georg Wieck
[L1842]: Sachsens Kirchen-Galerie. Schmidt - 8. Band: Abt. 9: Die Inspectionen: Chemnitz, Stollberg, Zwickau und Neustädtel. 1842
[L1842-1]: "Hoheneck" 1842 (S. 84 - Sachsens Kirchen-Galerie)
[L1842-2]: "Stollberg und seine Hauptgebäude" (3 Darstellungen des Schlosses) 1842 (S. 256 Sachsens Kirchen-Galerie)
[L1856]: "Hoheneck" in Erzgebirgischer Kreis Album der Rittergüter und Schlösser im Königreiche Sachsen 1856 von G. A. Poenicke
[L1886]: "Hoheneck" S. 59 in Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen - Amtshauptmannschaft Chemnitz 1886 von Richard Steche
[L1903]: Stollberg und das Ober-Erzgebirge in Sage u. Geschichte 1903 von Max Grohmann und Alfred Schuster
[L1922]: Geschichtliches über Schloß Hoheneck von Oberlehrer Barth in Hoheneck - 1922 Aus unserer Heimat - Heimatkundliche Zeitschrift für den Bezirk Stollberg und die angrenzenden Gebiete
[L1931]: Zur politischen Geschichte des Stollberger Bezirks im Mittelalter 1931 von Gerhard Schulz
[L1932_1940]: Heimatgeschichte der Pflege Stollberg i.E. 2005 von Dr. Löscher und Voigt 1932/1940 (ISBN 3-910186-55-6)
[L1937]: Schloß Freudenstein und sein Architekt, der kurfürstliche Baumeister Hans Irmisch 1937 Dissertation von Johannes Läuter
[L1971]: "Hoheneck" Ein Streifzug durch seine wechselvolle Geschichte in Heimatfreund Erzgebirge 1971 von Horst Rößler
[L1976_1978]: Zur Geschichte der Erzgebirgsstadt Stollberg 1976 - 1978 - Friedrich Schmidt im "Der Heimatfreund für das Erzgebirge"
[L1976_1978_1]: Zur Geschichte der Erzgebirgsstadt Stollberg (II. Teil)
[L1981]: "Stollberg Schloß und Herrschaft" S. 156 in Werte unserer Heimat - Zwischen Mülsengrund, Stollberg und Zwönitztal von Horst Rößler
[L1987]: "Hans Irmisch von Stollberg" in Erzgebirgisches Heimatblatt 1987 von Friedemann Bähr
[L1991a]: Irmisch und der Plan zum Schloßbau zu Hoheneck von Friedemann Bähr in Freie Presse Stollberger Zeitung 31.01.1991
[L1991b]: Stollberg wie es früher war im Erzgebirge 1991 von Friedemann Bähr
[L1992]: "Die alte Stalburg und ihr Herrschaftsgebiet" S. 15 und "Schloß und Dorf Hoheneck" S. 19 in Geschichte und Sagen Landkreis Stollberg - Ein Handbuch - Band 1 1992 von Horst Rößler
[L1993]: 650 Jahre Stadtrecht Stollberg E. 1993 von Stadtverwaltung Stollberg
[L1994_1996]: Historischer Bergbau in Thalheim - Ein Beitrag zur Heimatgeschichte erarbeitet von Bernd Descher 1994/96
[L2002]: Vergittertes Schloss Hoheneck im Wandel der Zeit 2002 von Stadtverwaltung Stollberg (ISBN 3-00-010867-X)
[L2011]: Stollberg - Die Große Kreisstadt im Bundesland Sachsen - Das Tour zum silbernen Erzgebirge 2011 von Horst Rößler, Stollberg (ISBN 978-3-00-035361-1)
[L2013]: Führer zu den Burgen und Wehrkirchen im Erzgebirgskreis 2013 von Volkmar Geupel (ISBN 978-3-943770-08-7)
[L2018a]: Stollberger Geschichte - Eine Zeittafel 2018 von Immanuel Voigt und Michael Wetzel
[L2018b]: Geschichte der Stadt Stollberg Band 1 Von den Anfängen bis 1830 von Michael Wetzel 2018 (ISBN 978-3-00-059925-5)
[L2018c]: "Archäologische Untersuchungen in Schloss Hoheneck in Stollberg (Erzgebirge)" In Ausgrabungen in Sachsen 6 2018 von Yves Hoffmann und Eric Mertens
Impressum
Autor: Michel Hilbert
E-Mail: kontakt@fergunna.de
Internet: www.fergunna.de
Titel: Schloss Stollberg – Verwaltungszentrum des kursächsischen Amtes Stollberg
© 2025 Michel Hilbert
Urheberrechtsschutz 1.0 (In Copyright)